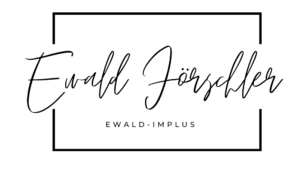12.3.25
Die Kraft der Vergebung. Aber was soll das sein? Meist, so meine Erinnerung, wird das Vergeben appellativ verstanden. Als gehörte es zur DNA eines Christen, dass er vergeben muss. Dann muss man also nicht nur die Feinde lieben, sondern auch noch denen vergeben, die es einem schwer machen. Irgendwie wird das dann alles zu viel. So viel Gutes und Bewegendes kann man gar nicht auf die Beine stellen ohne selber den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es muss also etwas anderes geben bzw. es muss da einen anderen Weg geben – heraus der Zwangsjacke. Einen Impuls gibt es in der heutigen Losung aus dem Propheten Jeremia: „Zur selben Zeit und in jenen Tage wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein, und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden; denn ich will sie vergeben.“ (50,20) Deutlicher als so kann man die Kraft der Vergebung nicht beschreiben. Sie ist derart wirksam, dass das, was sie vergibt, vom Erdboden verschwindet, als sei es nie dagewesen. Eben auch so, dass sie für den, der vergeben hat, nicht mehr auffindbar ist und nicht irgendwo so versteckt, dass man das Vergebene wieder hervorholen und präsentieren kann. Soll man da jetzt einen qualitativen Unterschied machen zwischen der Vergebungsfähigkeit Gottes und der Menschen? Was anleiten kann ist der Wille zum Vergeben. Es ist also eine Bereitschaft, die innerlich gereift ist und vollzogen wird. Der Vergebende tut das für sich, damit er der Beziehung, in der er bleiben will, eine neue Basis bekommt. Der andere, in diesem Fall das Volk Israel, weiß davon nichts. Es merkt nur, dass sein Gott ihm wohl will. Er muss es ihm nicht erklären. Das wäre doch in einer Beziehung zwischen Menschen auch denkbar. Dabei hat Vergeben eine so eigene Qualität wie auch das Versöhnen. Nur ist letzteres eben keine Individualaktion sondern eine zwischenmenschliche. Zu Herzen gehend die zwischen Jakob und Esau oder Jesus, dem Auferstandenen und Petrus. Gerade in der Passionszeit lohnt es sich, sich diese beiden unglaublich positiven Energien von Vergeben und Versöhnen bewusst zu machen.
„Selbstvertrauen und Depression Teil 1“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Unterstütze mich mit ko-fi.com/ewaldfoerschler
11.3.25
Eine große Rede am Ende. Josua, der Nachfolger des Mose, verlässt die Erde. Seine Aufgabe ist erfüllt. Er hat das Volk in das versprochene Land geführt. Er stirbt mit 110 Jahren und wird im eigenen Boden in Timnat-Serach auf dem Gebirge Ephraim bestattet. Diener des Mose war er und als solcher hat er seinen Dienst am Volk begonnen. Als Knecht des Herrn rückt er in die Reihe der Führergestalten Israels. Dass er im versprochenen Land bestattet werden konnte, unterscheidet ihn von Mose. Ein Teil des Vermächtnisses von Josua hört sich so an: „Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Ja!“ (Losung von heute aus Josua 24,22). Josua hat sein Volk offenbar sehr gut gekannt. Denn er lässt ihm die Wahl, ob es Jahwe oder anderen Göttern dienen will. Das entspricht der Situation, in der das Volk steht. Es ist nicht mehr unterwegs durch die Wüste, also auf Achse. Es ist angekommen. Und im Land ist ja schon ein Volk, das der Kanaaniter. Ein Volk, das wandert, hat einen Gott, der mitgeht. Ein seßhaftes Volk hat einen Gott, der Fruchtbarkeit schenkt, Baal. Das ist dann durchaus eine Krise, denn wie soll nun der Gott, der mitgegangen und vorausgegangen ist und beschützt hat, der sein, der auch Nahrung gibt? Deshalb stellt es Josua offenbar dem Volk frei, welchem Gott es dienen will. Das ist wichtig, wenn auch für ihn schmerzhaft. Denn er muss akzeptieren, für welchen Gott sich das Volk letztlich entscheiden wird. Da sagt es unisono: „Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen! Denn unser Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gezogen sind, und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind.“ (Josua 24,16.17) Und dann kann Josua das ans Volk zurückgeben und sagen: „Ihr habt euch selbst reden gehört. Ihr seid eure eigenen Zeugen. Niemand hat euch dazu gezwungen.“ Und dann hat Josua dieses heilige Versprechen mit konkreten Verhaltensregeln festgeschrieben.
Diese überzeugten Treueimpulse kennen wir auch aus dem Neuen Testament und von uns selbst. In dem Moment, in dem sie gegeben werden, ist man voller Inbrunst und überzeugt. Doch die kommende Zeit kann dieses Versprechen hart auf die Probe stellen. Schon mancher ist umgekippt. Mir steht Petrus vor Augen. Und damit sind wir mitten in der Passionszeit, die gerade mal eine Woche alt ist. Da gibt es viel nachzudenken…
„Friedrich Weinreb, holländischer Jude und Gelehrter der Kabbalah“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Spendiere mir einen Coffee auf ko-fi.com/ewaldfoerschler
10.3.25
Psalm 4, wenn man ihn sich zu Herzen lässt, ist eine Widerlegung des kausalen Denkens. Er führt einen also ins Gute, das kommt, obwohl man es nicht erwartet. Und so klingt er: Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstet in Angst; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet! Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern! Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt; der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Seid ihr zornig, sündigt nicht; redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hofft auf den Herrn. Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege oder schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. (Losung Psalm 4,9). Uwe Seidel war Pfarrer in der evangelischen Thomas-Kirchengemeinde in Düsseldorf, Mitarbeiter beim Deutschen-Evangelischen Kirchentag, in der Evangelischen und Katholischen Jugend „Gemeinsamer Kreuzweg der Jugend“ in der BRD und der DDR. Er hat den Psalm 4 wie folgt aktualisiert: Auge um Auge, Zahn um Zahn, fordert die Vergeltung. Sühne und Rache leiten unseren Spruch. „Du sollst deine Feinde lieben, und die dir Unrecht taten, bringe auf einen neuen Weg“, das denken nicht einmal Christen, viel weniger, dass wir danach handeln. Die Feindesliebe hat sich nicht durchsetzen können. Sie ist noch immer unpopulär und ungewöhnlich. Wie lange noch werden Menschen hinter Gittern eingebuchtet statt befreit? Wie lange noch werden sie bestraft statt geheilt? Wie lange werden sie geschlagen statt geliebt? Der verlorene Sohn jedenfalls bekam bei seiner Rückkehr ein Fest – und keine Festungshaft, obwohl er es mehr als toll getrieben hatte. Herr, du hast uns mehr Liebe gegeben als unsere Rechtsprechung ahnen lässt. Du hast mir den Atem gegeben für den langen Marsch durch die Institution. Du hältst mein Gewissen unruhig; denn den Frieden für alle will ich erreichen, auch für die Kriminellen, für die Gescheiterten und Ausgeflippten. Solange will ich mich nicht auf die faule Haut legen und weiterschlafen, bis dieses Ziel erreicht ist. Da alleine, Herr, hilfst mir, dass ich meiner Sache sicher bleibe.“
„daily basic – kausales Denken? Ohne mich!“ und „Predigt: Das Böse überwinden – aber wie?“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Spendiere mir einen Coffee auf ko-fi.com/ewaldfoerschler
9.3.25
Sonntag Invocavit – Hauptthema ist die Versuchung Jesu in der Wüste.
Und hier meine Auslegung dieses Sonntags mit dem Leitwort aus Römer 12,21: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Das Wort – welch ein gelungener Zufall – ist der Taufspruch eines Kindes, das im Gottesdienst in Herbolzheim an diesem Sonntag getauft wurde.
Ich möchte ein paar Takte zum Taufspruch von Aleyna sagen: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Ich habe in den griechischen Urtext geschaut und dann nicht schlecht gestaunt. Eigentlich gleich zwei Mal gestaunt. Das erste Mal, als ich das Wort las, das mit „Überwinden“ übersetzt wird. Dort steht ein Wort, das einer Sportschuhmarke den Namen gegeben hat: Nike! Siegerin. Also eigentlich müsste es heißen: Lass dich nicht besiegen! Das zweite Staunen kam sofort danach. Den zweiten Teil des Satzes übersetzt man am besten so: besiege im Guten das Böse. „Im“ ist tatsächlich eine Ortsangabe.
Was heißt das jetzt? Gut und Böse? Da ist man ja schnell dabei, passende Antworten zu finden. Das ist gut! Klar! Das ist böse! Auch klar! Ist es so? Wenn´s denn so ist, dann muss das ja auch in der Bibel klar sein. Das ist für mich eh die oberste Richtschnur. Mein Denken und Reden geht durch das, was vor mir gedacht und geschrieben wurde. Also! Hat jemand eine Idee, wo in der Bibel zum ersten Mal von gut und böse geredet wird? Richtig! In der Schöpfungserzählung. Es wird erzählt, dass im Paradies zwei Bäume standen. Paradies stammt im Übrigen aus dem Persischen und dort heißt es einfach nur „Garten“. In diesem Garten – wen wundert´s? – ist Gott gerne spazieren gegangen. Aber das nur nebenbei. Da standen also zwei besondere Bäume: der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Es heißt: es war überaus verlockend, von deren Früchten zu essen. Als dann zu allen anderen Lebewesen der Mensch dazukam, stellte Gott gleich ein Tabu auf: ihr könnt von allem essen. Nur vom Baum der Erkenntnis solltet ihr lieber nicht essen. Denn die Konsequenz dieses Essens ist der Tod. Der war also schon da, nur noch nicht so richtig wach. Und jetzt weiß man doch von jedem Kind und von uns wissen wir das doch auch: was verboten ist, ist besonders reizvoll. Und so passierte, was nicht hätte passieren dürfen: Eva greift zu und isst und Adam macht mit. Die Schlange, ein Symbol für Veränderung, hatte recht. Der Mensch ist nicht gestorben, aber der Tod kam trotzdem in sein Leben. Klug sein hieß fortan zu wissen, was gut und böse ist.
Was ist nun das Gute und was das Böse? Es ist das Wissen um zwei Aggregatzustände im Innern des Menschen. Nicht dass der Mensch gut sei oder böse – darum geht es nicht. Es geht darum, dass er es weiß, was gut und böse ist. Ich wurde auch mal aufgefordert, doch das Gute im Menschen zu sehen. Das mache ich aber nicht, weil ich da nicht suchen kann. Ich möchte auch nicht das Böse suchen. Ich möchte aber den Menschen ernst nehmen, der um gut und böse weiß. Seit dem Biss in die Frucht steht der Mensch mit seinem Wissen zwischen diesen beiden Aggregatzuständen. Es zieht ihn hin und her. Und Paulus meint jetzt: es ist Zeit, sich zu entscheiden, auf welcher Seite du stehen willst. Weil es immer darum geht, dass dich das Böse besiegen will. Das Böse ist leicht zu verstehen. Bei Saul heißt es, ein „böser Geist“ habe ihn ergriffen. Was war das für ein Geist, dieser böse Geist? Es ist der Geist der Kausalität, also Wenn-dann…Im hebräischen heißt böse „ra“. Das Wort für Same heißt „sera“, das auch getrennt als „se ra“ gelesen werden kann und dann heißt: „das ist böse“. Das heißt, man kann „Same“ auch mit „böse“ übersetzen. Das Böse also ist etwas, das seine kausale Reihenfolge erkennt und als alleinige Wirklichkeit anerkennt. Das wird in der Saat deutlich: Neues kommt, stirbt, neues kommt usf. Immer eine Kette von Ursache und Wirkung. So geht der Weg des kausalen Denkens in Zeit und Raum. Im Menschen ist es das Gefühl, dass ihm fortwährend etwas genommen wird. Das also ist der „böse Geist“: der Geist des Kausalen, der Geist von Ursache und Wirkung. Dieser Geist drückt sehr und deshalb lebt der Mensch in diesem Geist gedrückt. Er fühlt sich hintergangen. immer muss er was geben und weiß nicht, was er dafür bekommt. In der Saat ist also die Welt der Kausalität ausgedrückt: wenn ich säe, dann ernte ich. Wenn – dann. Kausalität. Ich will genau wissen, was passiert, wenn…Das ist der „böse Geist“. Ich bin gefangen in dieser Kausalität: Wenn ich so bin, dann wird es mir auch so gehen. Das Dumme ist nur: es ist eben selten bis gar nicht so. Gute Menschen erkranken an Krebs. Schlawiner erfreuen sich bis ins hohe Alter bester Gesundheit. Und trotzdem hat uns der böse Geist des Kausalen im Schwitzkasten. Er sagt: Du musst so denken: Wenn, dann. Es gibt nichts anderes. Vielen geht es im Gebet und im Glaubensleben auch so. Ich bete, damit…Ich glaube, weil…Dabei ist gerade das Gebet ein Lernfeld dafür, wie man sich dem Jenseitigen öffnen und damit über das Kausale hinauskommen kann. Beten ist die Hingabe, damit es kommen kann, und Bereit sein, zum empfangen, wie es kommt. Nicht das Hersagen von Formeln oder das Aufzählen von Wünschen. Beten ist kein Tun in dem Sinn, dass man etwas herbeibringen müsste. Glaube und Liebe kennen nur Hingabe und Hinnehmen, aber keinen Beweis und keine Technik, der man entnehmen könnte, wie es gehen soll, damit ein „Erfolg“ eintritt. Das nämlich, sagt Paulus, macht dich unzufrieden, lässt dich verzweifeln, setzt dich unter Druck, weil es ja stimmen muss, dieses Wenn-dann. Wenn du säst, dann…aber wenn das nicht aufgeht, was du säst? Wenn das Gute, das du säst, als Unkraut aufgeht? Wenn du diesem bösen Geist in dir weiterhin den Sieg überlässt, wirst du immer gefangen bleiben im kausalen Denken. Es wird dir keine Erfüllung sein, weil es keinen Sinn macht. Und jetzt mutet uns Paulus einen Sieg zu. Er sagt: beheimate dich im Guten, also in Gott – im Jenseitigen – und besiege so den bösen Geist. Rechne mit dem Guten unabhängig von Ursache und Wirkung. Setze darauf, dass dir etwas Gutes gesagt ist. Beharre auf dem Wort aus der jenseitigen Welt: „Du bist mein geliebtes Kind!“ Das ist dir gesagt ohne dass du die Ursache dafür wärst. Es ist dir gesagt, weil du geliebt bist – ohne Grund! Damit kannst du ein freier Mensch werden! Im Guten zu Hause: unser Glaube sagt – in Christus wohnen. Weil er die schlimmste Ursache-Wirkung-Wirklichkeit durchbrochen hat: Weil wir sündig sind, sterben wir! Nein – weil wir sündigen, werden wir begnadigt. Jetzt merken wir so langsam, worum es geht, nicht wahr? Um ein Denken und Fühlen dessen geht es, was größer ist als wir und uns deshalb aufatmen und frei sein lässt. Lass dir also nichts einreden von bösen Geistern, die meinen, sie könnten dich einkassieren in ihrem Ursache-Wirkung-Denken. Setze ihnen den Sieg Jesu darüber entgegen. In ihm hast du sie schon besiegt. Lache ihnen ins Gesicht! Ihr kriegt mich nicht! So hat es Jesus auch gemacht, damals in der Wüste. Der Versucher hatte keine Chance gegen ihn. Die eigentliche Versuchung war doch die: wenn du vor mir in die Knie gehst, dann…Ja, wer sagt dann, dass der Versucher Wort gehalten hätte? Wenn, dann…Auf diese Kausalität hat sich nicht eingelassen. Er hat sie standhaft besiegt. In ihm sein heißt, vor diesem bösen Geist des kausalen Denkens beschützt zu sein. Jesus war im Glauben an Gott verwurzelt war. Deshalb hat der Versucher ihn nicht erreicht. Umgekehrt: Jesus hat ihn innerlich besiegt. Und weil Jesus standhaft geblieben ist im jenseitigen Geist der Wahrheit, kann er sich dort in den Himmel frei bewegen und uns die Angst nehmen. Hier wie dort.
AMEN
„Autobiographische Erinnerung an den Katechismusunterricht“ und „Ist schon recht! Bist schon recht! Predigt zur Rechtfertigungslehre“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Gönne mir einen Coffee auf ko-fi.com/ewaldfoerschler
8.3.25
Simon Petrus sprach zu Jesus: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ (Lehrtext; Johannes 6,68) War Petrus verzweifelt? Wollte er Jesus schmeicheln? Petrus – der Gruppensprecher. Immer eine Nummer zu groß, was er sagt, was er macht, was er fragt. Trotzdem: seine Frage hat Gewicht. Sie kommt aus dem Inneren. Und sie hat einen Vorlauf. Ihr geht ein schwerer, interner Konflikt im Jüngerkreis voraus. Er entbrannte sich an einer Rede, die Jesus in der Synagoge in Kapernaum gehalten hat. Wörtlich hat er dort gesagt: „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wie dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.“ (Johannes 6,37.38). Es ist halt ein Unterschied, ob ich in einem Bethäuschen in Nazareth so was sage oder im Freiburger Münster. Natürlich haben die Jünger auch zugehört. Und sie meinten, das sei eine harte Rede gewesen und sie fragten sich, wer das hören kann. Jesus bemerkte die aufkeimende Revolte und fragte die Jünger: „Ärgert euch das? Die Worte, die ich geredet habe, sind Geist und Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht.“ Da fühlten sich bestimmte Jünger entlarvt und trennten sich von ihm. Das hat Jesus nicht kalt gelassen und nach diesem Schock fragte er die, die geblieben waren: „Wollt ihr auch weggehen?“ Da machte sich Petrus zum Gruppensprecher und sagte: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ Die Jünger, die gegangen sind, waren im Diesseits verhaftet. Sie konnten den Worten, die Jesus in der Synagoge sprach, keinen Glauben schenken. Glaube aber ist zu „sehen“, dass Worte aus der jenseitigen Welt kommen („Worte des ewigen Lebens“) und deshalb heilig genannt werden und dass der, der sie sagt, ein Bote der jenseitigen Welt im Diesseits ist, eben ein Heiliger Gottes. Genau das bekennt Petrus. Und Jesus wusste fortan, dass er sich auf diese Jünger, die geblieben waren, verlassen kann. Nun! Der weitere Weg zeigt ihre menschlichen Schwächen schonungslos auf. Das ändert aber nichts daran, dass sie ihm glaubten.
„Eine Partie Dogmatik spielen“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Gönne mir einen Coffee ko-fi.com/ewaldfoerschler
7.3.25
„Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen.“ (Lehrtext heute aus Matthäus 5,37). Man muss diese Anweisung Jesu in der Bergpredigt im Zusammenhang mit dem Erbringen eines Treueeides verstehen. Jesus lehnt das Schwören eines Eides jeglicher Art ab. Jesus geht es um die völlige Wahrhaftigkeit, die ohne Eid auskommt. Der Eid ist der Beweis für die Lüge in der Welt. Könnte der Mensch nicht lügen, so wäre kein Eid notwendig. So ist der Eid zwar ein Damm gegen die Lüge. Aber eben darin fördert er sie auch. Denn dort, wo allein der Eid letzte Wahrhaftigkeit beansprucht, ist zugleich der Lüge im Leben Raum gegeben, ist ihr ein gewisses Lebensrecht zugestanden. Das alttestamentliche Gesetz verwirft die Lüge durch den Eid. Jesus aber verwirft die Lüge durch das Verbot des Eides. Es geht hier wie dort um das Eine und Ganze, die Vernichtung der Unwahrheit im Leben der Glaubenden. Die Lüge muss von Jesus dort gefasst werden, wohin sie sich flüchtet, im Eid. Darum muss der Eid fallen, weil er zum Schutz der Lüge geworden ist. Stattdessen gilt: Eure Rede sei Ja, ja und Nein, nein. Dadurch wird jedes Wort des Jüngers Jesu gerade dadurch, dass der Name Gottes nicht angerufen wird, unter die Gegenwart des allwissenden Gottes gestellt. Weil es überhaupt kein Wort gibt, das nicht vor Gott gesprochen wäre, darum soll der Jünger nicht schwören. Jedes seiner Worte soll nichts als Wahrheit sein, so dass keines der Bestätigung durch den Schwur braucht. Der Jünger soll mit allen seinen Worten Licht sein. Von daher ist es geradezu unglaublich zu erfahren, dass die Deutsche Evangelische Nationalsynode unter dem deutsch-christlichen Bischof Ludwig Müller am 9. August 1934 beschlossen hat, für Geistliche und Beamte einen Eid zu fordern „dem Führer des deutschen Volkes und Staates Adolf Hitler treu und gehorsam zu sein“. Das Bekenntnis von Barmen aus demselben Jahr spricht da eine andere Sprache, bringt einen anderen Geist zum Vorschein. Die Spaltung der evangelischen Kirche in Bekennende und Deutsch-christliche war vollzogen. Erstere war sich im klaren darüber: es gibt keine Nachfolge Christi ohne das Leben in der aufgedeckten Wahrheit vor Gott und den Menschen.
„Inside Heidelberger Katechismus“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Spende mir einen Coffee ko-fi.com/ewaldfoerschler
6.3.25
Ist es doch immer wieder überraschend, welche Resonanz Worte auslösen. Als ich die ersten Worte der heutigen Losung las, kam in mir sofort ein Kanon zum Klingen, der in meinem Elternhaus öfters gesungen wurde: „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn.“ (Maleachi 1,11) Jetzt weiß ich auch, dass er an die Worte aus dem Propheten Maleachi angelehnt ist. Maleachi – den kennt ja keiner!? Im Studium oder auch sonst ist er nicht als besonders bedeutsam aufgetaucht. Das liegt bestimmt nicht daran, dass er die letzte Schrift des Alten Testaments ist. Ein paar Takte zu Maleachi. Der Name bedeutet „mein Bote“. Mit dieser Bedeutung kommt das hebräische Wort in Kapitel 3,1 vor: „Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht; und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt! spricht der Herr Zebaoth.“ Ob Maleachi als Eigenname gelten kann, ist nicht sicher. In den Worten dieses Prophetenbuches spiegeln sich Verhältnisse, die uns teils von dem Propheten Haggai, teils aus den Büchern Esra und Nehemia bekannt sind. Existenzsorgen werden angesprochen und auch die Frage der Mischehen mit nichtjüdischen Frauen. Der Tempel ist wieder aufgebaut, aber Judäa ist nur eine unbedeutende persische Provinz. Die von anderen Propheten – einschließlich Haggai und Sacharja – angekündigten großen Veränderungen waren ausgeblieben und allgemeine Entmutigung machte sich breit. Der Gottesdienst entartete zu einer oberflächlichen Einhaltung von Formen. Die Gebote Gottes versuchte man zu umgehen. Ob Maleachi vor oder nach Esra und Nehemia aufgetreten ist, lässt sich nicht abschließend entscheiden. Das Buch Maleachi enthält sechs Reden in Disputationsform. Eine vom Propheten vorgetragene These ruft jeweils den Einwand der Angesprochenen hervor und wird daraufhin begründet. Die nachdrückliche Betonung gottesdienstlicher (1,6,14) und sittlicher (2,10-16) Forderungen knüpft an alte prophetische Traditionen an. Das Buch beginnt überraschend: Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht: „Woran sehen wir, dass du uns liebhast?“ Das geht dann überraschend so weiter…
„Unfriede als fundamentales Problem des Menschen“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Spende mir einen Coffee ko-fi.com/ewaldfoerschler
5.3.25
Die entscheidenden Worte kann man sich nicht selber sagen. Man kann versuchen, sich in bestimmten Situationen selbst zu trösten. Doch selbst dieser Trost ist etwas, der einst von außen zugesprochen wurde und zu einem Teil einer selbst geworden ist. Heute ist Aschermittwoch. Liest man die Bibeltexte zu diesem Tag, kann es einem wirr werden im Kopf. Da ist von Sünden die Rede, dem Tod als Sold der Sünde und dass Gott nicht mehr hinsehen kann oder will. Vielleicht sollte man an so einem Tag auch weniger von Gott reden als von den Menschen. Gott verbockt ja nichts. Das machen die Menschen. Ich bin mit ziemlich wachen Sinnen durch diese närrischen Tage gegangen. Gestern habe ich mir im Fernsehen die Veranstaltung aus Köln angeschaut. Es ist dort ein Clown aufgetreten. Ich fragte mich: Wie lange braucht der eigentlich, bis er auf den Punkt kommt? Bis der Clown dann antwortete, er wolle gar nicht auf den Punkt kommen, sondern einfach nur Blödsinn erzählen. Das fand ich cool. Er wusste, was er wollte. Er wollte Blödsinn erzählen und die Leute zum Lachen bringen. Er war zum Lachen. Situationskomik. Ich sehe so was immer auch im Hinblick darauf, was man daraus für Auftritte in der Kirche lernen kann. Wir reden ja auch und hoffentlich nicht so viel Blödsinn wie dieser Clown. Vorbild ist er darin, dass er den Leuten sagt, was er macht und denkt. Bei manchen Leuten, die bei uns vorne stehen auf Kanzel oder am Pult, frage ich mich oft: Wissen die, was sie sagen? Schenke die den Leuten reinen Wein ein? Ich sag´s mal so: eine schöne Predigt gibt es nicht und darf es auch gar nicht geben. Eine Predigt, soll sie ein Ereignis sein, muss aufrütteln, aufregen, irritieren, zu Protest und Fragen erregen. Das schuldet sie der Botschaft, die einzig den Sinn hat, dass ihr Inhalt die Leute transformiert in einen anderen Zustand. Das geht nicht mit Schmeichelei. Das machte der Prophet Jesaja auch nicht, wenn er sagte: „Eure Sünden haben des Herrn Angesicht vor euch verdeckt, so dass er nicht hört.“ (Losung von heute; Jesaja 59,2) Einfach mal so stehen lassen. Nicht gleich beschwichtigen. Nicht gleich sagen: Es nicht so schlimm. Doch. Es ist schlimm. Die Leute machen böse Sachen. Die Leute sind böse. Sie sündigen. Sie verletzen. Sie morden. Sie stehlen. Sie lügen. Das ist so. Diese Sünden haben eine Macht. Sie bauen sich auf wie eine Wand, die es den Menschen unmöglich macht, vor Gott zu treten. Ihre Sünden stehen zwischen ihnen und ihrem Gott. Das ist schlimm und so viel an Dreck, dass Gott zwar gerne hören will, aber eben nicht mehr hören kann. Das liegt nicht an ihm. Da müssen die Leute einfach mal aufräumen in ihrem Leben und nicht rumjammern, dass Gott nicht hört. Schieb Gott also nicht in die Schuhe, was du in Ordnung bringen musst. Klingt zwar nach Aschermittwoch. Ist aber leider an der Tagesordnung. Der Losung von heute geht folgendes Wort voraus: „Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte.“ (59,1) Wenn´s dann anders ist und Gott nicht mehr hören kann, muss sich der Mensch an die eigene Nase fassen.
„Plädoyer für ein Revival“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Unterstütze mich (mit Maus anklicken) ko-fi.com/ewaldfoerschler
4.3.25
„Als Jesus in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der?“ (Lehrtext aus Matthäus 21,10) Eine berechtigte Frage. Denn die Leute interessiert es offenbar, wer der ist, der hier wie ein König in die Stadt einzieht. Sie interessieren sich für die Person, nicht für die Funktion. Sie hätten ja auch fragen können: Wer ist dieser König, der hier einzieht? Sie wollen aber wissen, wer das ist. Kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass so etwas geschieht in einer Metropole wie Jerusalem, wo alles klar geordnet ist zwischen römischer Besatzungsmacht und religiöser Elite am Tempel. Da hat so ein Ereignis wie dieses keine Nische. Diejenigen, die jubelnd Jesus begleiten, geben Auskunft: „Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.“ (21,11) Diese Antworte musste irritieren. Denn der Einzug ist wie der eines Königs. Ein Prophet zieht aber nicht so ein wie ein König. Das ist seltsam. Das passt nicht zusammen. Man kann sich über eine Zeichenhandlung dem Ganzen annähern. Leute, die mit Jesus einzogen, breiteten die Kleider vor ihm aus. Das wird ein Mal in der hebräischen Bibel von einem König wie folgt berichtet: Ahab war mit Isebel verheiratet. Isebel war Anhängerin des Baalkultes und ihr Mann Ahab war als König Israels selbstverständlich Jahwe verpflichtet. Aber er konnte sich gegen seine Frau nicht durchsetzen. Und das wurde ihm übelgenommen. Deshalb entschied der Prophet Elisa, Nachfolger des Elia, einen anderen, nämlich Jehu, heimlich zum König salben zu lassen. Das ist offenbar eine Vorgehensweise von Propheten. Samuel hat dasselbe mit David gemacht und damit die Rivalität zu Saul provoziert. Ein Prophetenjünger von Elisa salbt also heimlich den Jehu zum Konkurrenzkönig von Ahab. Als Jehu das seinen Gefolgsleuten eröffnet, reagieren die spontan, indem sie ihre Kleider nahmen und vor ihn hinlegten. Das muss als Treuebekundung verstanden werden. Die Kleidung steht stellvertretend für die Person, die die Kleider anhat. Genau dieselbe Zeichenhandlung wird auch von den Anhängern Jesu bei seinem Einzug in Jerusalem erzählt. Wer die Jehugeschichte kennt weiß jetzt, dass der Prophet, der da in Jerusalem einzieht, eigentlich ein König ist. Doch genauso wie Jehu heimlich zum König gesalbt wurde, ist Jesus ein verborgener König. Das macht seine Größe und sein Geheimnis aus, das allen ein großes Rätsel wurde. In einer Großstadt wie Jerusalem kennt man das galiläische Land nur vom Hörensagen. Und Nazareth war eine noch junge Siedlung aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, ein Kaff mit knapp 200 Einwohnern. Nach Nazareth führte keine offizielle Straße. Es lag abgelegen. Also – Prominenz zog da nicht gerade in Jerusalem ein. Ein Ländler – was will der hier? Und wie ergeben sind ihm seine Gefolgsleute! Was soll das werden?
„Alles andere als langweilig -Plädoyer für ein Frage-Antwort-Spiel“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Unterstütze mich mit (mit Maus anklicken) ko-fi.com/ewaldfoerschler
3.3.25
„Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt.“ (Lehrtext aus Matthäus 7,14) Wie sind diese Worte Jesu zu verstehen? Als Mahnung? Als Erinnerung? Als Ausruf der Wahrheit? Sie sind aus der Bergpredigt (Kapitel 5-7 Matthäusevangelium), einer Redekomposition der Kernüberzeugungen Jesu. Das Beste, das ich kenne, hat Dietrich Bonhoeffer dazu in seiner „Nachfolge“ geschrieben: „Eine kleine Schar, die Nachfolgenden, wird getrennt von der großen Zahl der Menschen. Die Jünger sind wenige und werden immer wenige sein. Dies Wort Jesu schneidet ihnen jede falsche Hoffnung auf Wirksamkeit ab. Niemals setze ein Nachfolger Jesu sein Vertrauen auf die Zahl…Der Weg der Nachfolgenden ist schmal. Leicht geht man an ihm vorüber, leicht verfehlt man ihn, leicht verliert man ihn, selbst wenn man ihn schon beschritten hat. Er ist schwer zu finden. Der Weg ist wahrhaftig schmal, der Absturz nach beiden Seiten bedrohlich: Zum Außerordentlichen gerufen sein, es tun, und doch nicht sehen und wissen, dass man es tut, – das ist ein schmaler Weg. Die Wahrheit Jesu bezeugen und bekennen und doch den Feind dieser Wahrheit, seinen und unseren Feind, lieben mit bedingungsloser Liebe Jesu Christi – das ist ein schmaler Weg. Der Verheißung Jesu glauben, dass die Nachfolgenden das Erdreich besitzen werden und doch dem Feind wehrlos begegnen, lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun – das ist ein schmaler Weg. Den anderen Menschen sehen und erkennen in seiner Schwäche, in seinem Unrecht, und ihn niemals richten, ihm die Botschaft ausrichten müssen und doch die Perlen niemals vor die Säue werfen – das ist ein schmaler Weg. Es ist ein unerträglicher Weg. Jeden Augenblick droht der Abfall. Solange ich diesen Weg als den mir zum Gehen befohlenen erkenne und ihn in der Furcht vor mir selbst gehe, ist er in der Tat unmöglich. Sehe ich aber Jesus Christus vorangehen, Schritt für Schritt, sehe ich allein auf ihn und folge ihm, Schritt für Schritt, so werde ich auf diesem Wege bewahrt. Blicke ich auf die Gefährlichkeit meines Tuns, blicke ich auf den Weg anstatt auf den, der ihn mir selbst vorangeht, so ist mein Fuß schon im Gleiten. Er selbst ist ja der Weg. Er ist der schmale Weg und das enge Tor. Ihn allein gilt es zu finden. Wissen wir das, dann gehen wir auf dem schmalen Weg durch die enge Pforte des Kreuzes Jesu Christi zum Leben, dann wird uns gerade die Enge des Weges zur Gewissheit. Wie sollte der Weg des Sohnes Gottes auf Erden, den wir als Bürger zweier Welten am Rande zwischen Welt und Himmelreich zu gehen haben, auch ein breiter Weg sein? Der schmale Weg muss der rechte Weg sein…“
Unterstütze mich mit (mit Maustaste anklicken) ko-fi.com/ewaldfoerschler
2.3.25
Predigt zu Marta und Maria auf dieser Homepage unter „Predigten“.
Zwischenruf: Selenskij und Trump auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Unterstütze mich mit (mit Maustaste anklicken) ko-fi.com/ewaldfoerschler
1.3.25
Wieder eine traumatische Demütigung. Nicht die erste und auch nicht die letzte. Mit der ersten begann die Werdung des Volkes Israel. Wenn ein Haufen Entrechteter entrechtet, unterdrückt und zu Sklavenarbeit verdingt wird, dann ist das ein Trauma. So fing das an mit dem Volk Israel. In dieser Erniedrigung in Ägypten hat ein Gott diesem Häufchen Elend seine Aufmerksamkeit geschenkt und ihm sagen lassen: „Ich bin bei dir. Ich werde bei dir sein. Ich werde mit dir sein.“ Es war die Stimme der Freiheit, die Würde und Ehre schenkt. Seitdem ist dieser Gott an dieses Volk gebunden. Die Überwindung des ersten Traumas gehört zur Urerfahrung Israels und ist fest verankert in seiner Erinnerungskultur. Doch die Erinnerung an die Schrecken ist immer verbunden mit der Erfahrung, dass Gott zu ihm hält. Nicht dass er verhindern könnte oder würde, was Menschen anrichten, so wünschenswert das wäre. Aber ihn anzuflehen ist wenigstens etwas, das noch bleibt, wenn alles genommen wird bis hin zur eigenen Würde. Die Geschichte des Volkes Israel wird auch weiterhin begleitet sein von Traumata: von Eroberung durch die Babylonier, die Römer, Zerstörung, Demütigung, Deportation, Ausgrenzung, Holocaust und erneuter Traumaverursacher wie zurzeit. Der neue Schrecken beginnt mit Worten und Verharmlosung des Geschehenen. Die einzige Medizin, die das Volk Israel hat, ist seine Erinnerung an die befreienden Taten seines Gottes. Nicht umsonst bzw. gerade deswegen ruft der exilische Trostprophet das Volk auf: „Denkt an den Anfang, an das, was schon immer war: Ich bin Gott und keiner sonst, ich bin Gott, und meinesgleichen gibt es nicht.“ (Losung von heute aus Jesaja 46,9). aKann es sein, dass die Unvergleichlichkeit Gottes ein tiefer, innerlich bewegender Trost für entwurzelte Menschen ist? Sollte ein solcher Mensch keine Erfahrungen mit diesem Gott haben, wäre für ihn aber ein Trost, sich einzubetten in die Erinnerungskultur des Volkes Israel. Und seines berühmten Sohnes Jesus, der als Erster von den Toten auferweckt wurde. Auch so eine Erzählung gegen die Ohnmacht, in die der Tod den Menschen zwingen will.
„Jesus und die Kinder“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Unterstütze mich mit (mit Maustaste anklicken) ko-fi.com/ewaldfoerschler
28.2.25
Der Beter des Psalms 66, eines Opfer- und Dankliedes, entstammt nicht dem Kreis der Armen und Bedrückten. Die Fülle der Opfer (Vers 15), die er darbringt, lässt einen recht begüterten Mann vermuten. Er erst recht hat von den Guttaten zu erzählen, die der Gott Israels auch für ihn gewirkt hat. Immer wieder – so auch hier in Psalm 66 – wird an die konkreten Geschichtstaten Gottes erinnert – die Befreiung eines „Haufen Sklaven“ aus der Sklaverei in Ägypten und die Bewahrung auf dem Fluchtweg (3-6). Die Erinnerung wird hier wie auch in der jüdischen Tradition und der christlichen Osterliturgie stehts wieder von neuem zur Hoffnung, wie Jehuda Halevi in seinem Gedicht „Am Schilfmeertag“ schreibt: „Lass deinen Erlöserarm, der einst schlug deine Schlacht, erglänzen wie damals, reiß die Fahne aus der Nacht!“ Daran erinnert die heutige Losung: „Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen, wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt und erquickt.“ (66,12) Der unergründbare „furchtbare“ Gott ist eindeutig in seinen Geschichtstaten. Seine Namenhaftigkeit ist undurchsichtig. Simone Weil: „Wir wissen nichts von Gottes Wesen, aber wir wissen, was er uns tut.“ Der hymnische Psalm klingt geradezu überschwänglich und lässt vermuten, dass Jahwe als Herr der Geschichte ausgerufen wird. Wird er das wirklich? Wenn man heilig ernst macht mit der „undurchsichtigen Namenhaftigkeit“ dieses Herrn und heilig ernst macht mit der Einsicht, dass wir nichts von Gottes Wesen wissen, dann kann das nur heißen: wenn der Herr der Geschichte, dann ist er ein anderer Herr als die Herren der Geschichte und anders, als man sich Herrschaft vorstellt. Noch der Shoah (Judenvernichtung der Nazis) ist mit dem Begriff „Herr der Geschichte“ jedenfalls höchste Vorsicht und Zurückhaltung geboten. Am besten wird es sein, auf den Begriff zu verzichten. Es gibt zu viele Fehlverständnisse. Franz Rosenzweig sagt es so: „Der Gott der Welterneuerung ist Israels alter Gott.“ Damit ist die Botschaft dieses Psalms und die Geschichtsmächtigkeit Jahwes hinlänglich beschrieben. Die „Furchtbarkeit“ (3+5) der Taten Gottes in Psalm 66 hat nichts zu tun mit der Furchtbarkeit von Auschwitz.
„Kind sein – in der Erziehung“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Unterstütze mich mit (mit Maustaste anklicken) ko-fi.com/ewaldfoerschler
27.2.25
Samuel ist voll auf der königskritischen Linie. Er hat zwar dem Volk der Israeliten seinen Willen gelassen und Saul zum König gesalbt. Aber er sieht darin die Gefahr, dass das Volk alles vom König erwartet und vergisst, dass Gott sein König ist. Mit etwas Vernunft kann man dahinter auch einen Machtverlust des Samuel sehen, denn er wird vom Volk nur noch als der wahrgenommen, der einen König salbt, aber letztlich tut, was das Volk will. Man spürt seiner Abschiedsrede in 1. Samuel 12 an, dass ihm diese Zuschreibung nicht gefällt. Deshalb zeigt dem Volk noch einmal seine Autorität als Prophet. Nach dem ersten großen Sieg Sauls lädt er das Volk zur Vollversammlung zum Heiligtum in Gilgal. Und zwar zur Zeit der Weizenernte. Er schärft dem Volk ein, immer den Willen seines wahren Königs Jahwe zu tun. Zum Beweis dafür, dass Gott der Herr ist, ruft ihn Samuel an und Gott lässt es donnern und regnen. Da war die Weizenernte hinüber. Das Volk aber war stark beeindruckt bis erschrocken. Genau das wollte Samuel erreichen, denn das Volk sah jetzt ein, dass es etwas getan hat, was Gott nicht gefallen hat. Er wollte sein König sein und ein irdischer König konnte er nur als Rivale ansehen. Aber eben nur wegen der Schwäche des Volkes, das sich vom Schein schnell gefangen nehmen lässt. In der königskritischen Linie der Bibel zeigt sich grundsätzlich die Skepsis gegenüber allen Mächtigen, die ihre Macht aus sich heraus begründen. Die Frage ist tatsächlich, ob dieses „So wahr mir Gott helfe!“ bei der Einführung von Amtsträgern nur als Floskel gesehen werden kann. Gerade in dieser Formulierung steckt die tiefe Überzeugung, dass es für ein hohes Amt mehr braucht als den eigenen Willen und die eigene Stärke. Es braucht ein höheres Bewusstsein, das einhergeht mit Demut und Dankbarkeit und den Hang zur Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit deutlich begrenzt. So ist das Vermächtnis des Samuel immer noch aktuell, wie es in der Losung für heute steht: „Dient Gott von ganzem Herzen. Und weicht nicht ab; folgt nicht denen, die nichts sind, die nichts nützen und nicht retten können, denn sie sind nichts.“ (1. Samuel 12,20.21) Es lohnt sich, die ganze Abschiedsrede zu lesen und zu reflektieren. Jedem vernünftigen Menschen wird es nicht schwerfallen, einen aktuellen Bezug herzustellen und sich eine eigene Meinung zu bilden.
„Kind sein – schmerzhafte Erinnerung“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
26.2.25
Nachts kommt Nikodemus zu Jesus. Er war aus der Elite der Pharisäer. Manche sagen, er sei nachts zu Jesus gekommen, weil er sich tagsüber nicht traute oder als wollte er das vor den anderen verheimlichen. Das hat ein Pharisäer aber gar nicht nötig und schon gar nicht Nikodemus. Die Zeitangaben wählt das Johannesevangelium nicht zufällig. Sie sagen etwas Symbolisches aus. Das gilt auch für die Nacht, in der Nikodemus zu Jesus kommt. Die Dunkelheit steht für die Innenwelt des Nikodemus. Er weiß viel, er hat einen Status, er ist anerkannt. Aber er ist nicht „erleuchtet.“ In ihm ist es dunkel. Er kommt zu Jesus und beginnt gleich das Gespräch. Gespräch? Eigentlich nicht. Denn Nikodemus gibt eher ein Statement ab: „Meister (=Rabbi), du bist ein Lehrer (=didaskalos) von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun (=dynamis), die du tust, es sei denn Gott mit ihm.“ (3,2) Das war´s. Ist Nikodemus zu Jesus gekommen, um ihm das zu sagen? Er hat keine Frage an ihn. Er hat kein Interesse an einer theologischen Auseinandersetzung oder grundlegenden Diskussion, wie es die Pharisäer gerne haben. Nichts von alledem. Nikodemus will Jesus nachts begegnen, um ihm zu sagen, dass er und seine Kollegen der Überzeugung sind, dass Jesus von Gott kommt. Jesus braucht nichts zu erwidern. Er könnte einfach nur Danke! sagen und sich freuen. Stattdessen wird er zum Lehrer und Erklärer. Er spricht von Neugeburt bzw. Wiedergeburt. Das ist etwas anderes als Reinkarnation nach dem Tod. Neu- bzw. Wiedergeburt meint einen vorsterblichen Prozess und zwar den Prozess eines spirituellen Erwachens zur Wirklichkeit, die der Realität zugrunde liegt. Ein Erwachen zu der Wirklichkeit, die Gott als Grund des Lebens erkennt. Dort angekommen ist es so, als würde man in ein unsichtbares Wachsen hineingelegt, das das Erkennen zum Ziel hat. Das ist dann die Neugeburt. Eine Erkenntnis kommt zur Welt. Hannah Arendt nennt diesen Vorgang Natalität. Er geschieht durch Transformation. Kurzum könnte man auch sagen: es ist ein Erkennen der Anwesenheit Gottes in der Zeit. Das ist eine Tat des Geistes (=pneuma), den Johannes als Wind versteht. Man sieht ihn nicht und doch hat er die Kraft, Entscheidendes im Menschen zu bewegen. Das ist der Sinn des heutigen Lehrtextes: „Jesus sagt: der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.“ (Johannes 3,8)
„Kind sein in der Antike und in der Bibel“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
25.2.25
In Psalm 118 werden verschiedene Stimmen laut. Sie dürften im Wechsel gesungen worden sein im Rahmen einer festlichen Prozession, die zum Tempel und an die „Pforte Jahwes“ (20) führte, wo eine „Pfortenliturgie“ stattfand. „Beim Eintritt in den Tempelbezirk ist von jedem Kultteilnehmer eine Loyalitätserklärung abzulegen, den einzig die Zaddikim, die Bewährten (20b) dürfen durch die Pforte Jahwes in das Heiligtum eintreten. Zur Festzeit zog die Schar der Lobenden und Dankenden in einer Prozession durch die Tore ein und wurde um Eingang in liturgische Wechselgespräche- und gesänge hineingenommen.“ (Hans-Joachim Kraus). Danach sprachen die Priester den Segen über der Gemeinde, die sich in einem Tanzreigen zum Opferaltar weiterbewegte. Das Hin und Her zwischen Einzel- und Kollektivstimme macht deutlich, dass in den einzelnen Stimmen der Dank und das Zeugnis der einzelnen lebendig ist. Diese Verflochtenheit des Ichs mit dem Wir liegt der damaligen Kultgemeinschaft zugrunde. Die Vers 5-21 sprechen verschiedene Lebenssituationen an. Aus einer Bedrängnis durch feindselige Menschen (V6) half Jahwe ins Weite und verschaffte dem Flehenden neuen Bewegungsspielraum. Interessant ist, dass in Vers 7 Jahwes Hilfe in „Helfern“ am Werk war, ein durchaus moderner Gedanke. Der Selbstvergewisserung in der heutigen Losung („Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.“ V14) geht eine bedrohliche Situation voraus. Der Beter wurde umringt von feindlichen Völkern (V10), sodass hier durchaus an ein kollektives Ich zu denken ist. Er sollte zu Fall gebracht werden. Doch – und das ist der Grund für das überschwängliche Lob – Jahwe hat „mir“ geholfen.
Glaubenserfahrungen haben hier eine zweifache Verwurzelung. Zum einen in der Liturgie des Tempels und zum anderen in der feiernden Gemeinschaft. Solch ein systemisches Verankert sein des einzelnen hat noch selten zu Vereinsamung geführt, wie sie heute so zahlreich beklagt wird.
Start der Episodenreihe „Kind sein“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
24.2.25
Wer ist ein Prophet? Das Wort stammt aus dem Griechischen prophetes und bedeutet nicht „einer, der etwas vorher- oder voraussagt“, sondern das „vor“ hat den Sinn: vor allen Leuten, vor der Öffentlichkeit. Der Prophet ist einer, der vor der Öffentlichkeit etwas redet oder verkündet. Dasselbe bedeutet wahrscheinlich der dem Griechischen zugrunde liegende hebräische Ausdruck (nabi). Er wird auch „der Verzückte“ gedeutet. Propheten reden von Gott, insofern sind sie Gottes Botschafter in dieser Welt. In der ersten Periode der Prophetie im Volk Israel, um die Mitte des 8. Jahrhunderts v.Chr., tritt im Nordreich wie im Südreich ein Prophet auf, der mit besonderer Leidenschaft eine soziale Anklage erhebt: im Nordreich Amos, im Südreich Micha. In der sozialen Anklage, die Amos in seinem Volk erhebt, geht es um Schäden im Leben des Volkes. Es gibt ein durchaus gesundes, normales Nebeneinander von Reichen und Armen. Amos aber geht es ganz und gar nicht um ein Prinzip, etwa das Prinzip der Gleichheit. Seine Anklage richtet sich nicht gegen den Reichtum oder die Reichen als solche, sondern sie setzt da ein, wo in das Zusammenleben von Reichen und Armen offensichtliche Schäden und Verderbnisse eingedrungen sind. Drei solche Schäden hebt er besonders hervor: die Verderbnis der Rechtsprechung durch Bestechung und Beeinflussung durch die Reichen, das Enteignen der Armen unter dem Deckmantel des Rechts (das Pfänden), das „Bedrücken“ der Armen, das Treten und Wegdrängen, das den Armen ihre Ehre nimmt. Amos hat erkannt, dass die soziale Frage im tiefsten Grund eine Frage der Ehre ist. Und so liest man in der heutigen Losung ein Wort des Amos: „Ihr trinkt den Wein kübelweise und verwendet die kostbarsten Parfüme, aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt.“ (6,6) Einen Vers weiter spricht Amos vom „Schlemmen der Übermütigen“. Sie sind die „Sorglosen“. Ihre Macht, ihr Status, ihr Reichtum macht sie sorglos und übermütig. Er prophezeit ihnen, dass sie, wenn es zum Exil kommen wird, den Tross der Gefangenen anführen werden. Es reicht hier nicht festzustellen, dass Reiche in der Regel in einer Dauerkrise leben, die ihnen der Überfluss beschwert. Es reicht tiefer. Sie haben vergessen, dass Reichtum nicht ohne soziale Verpflichtung zu haben ist. Reichtum soll nicht verprasst oder verlebt, sondern zur Linderung von Elend und Armut eingesetzt werden. Damals wie heute!
23.2.25
Endlich Sonntag! Der Sonntag ist nach christlichem Verständnis der erste Tag der Woche. In der christlichen Tradition beginnt also die Woche mit einem Feiertag. Kern des Sonntags ist die Botschaft von der Auferweckung Jesu von den Toten. Deshalb wird der Sonntag in anderen Ländern auch „Tag des Herrn“ genannt. Die Tage, die dem Sonntag folgen, beziehen sich auf die entscheidenden Tage im Leben Jesu. So ist der Donnerstag der Gründonnerstag („grün“ kommt von „greinen“, was „weinen“ oder „klagen“ bedeutet), der Freitag ist der Karfreitag und der Samstag ist der „stumme Tag“, der Tag des Schweigens, der in den Osterjubel mündet, in den die Gemeinde am Sonntag einstimmt. In den Gottesdiensten wird heute eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte 16,9-16 ausgelegt:
Und Paulus hatte eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns! Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.
22.2.25
Glaube ist kein Wunschkonzert. Wer auf dem jüdisch-christlichen Weg geht, ist sich im Klaren, dass er von Hoffnung und Sehnsucht begleitet wird. Er ist also nicht allein unterwegs. Es gilt, sich diese beiden bekannt und vertraut zu machen und der Versuchung zu widerstehen, sie dafür verantwortlich zu machen, dass Wünsche in Erfüllung gehen oder irgendeine Erfüllung überhaupt geschieht. Im Gegenteil. Hoffnung und Sehnsucht sind die Energien, die einen voranbringen. Jesus hat die Menschen, die sich an Hoffnung und Sehnsucht binden, mit den Worten beglückwünscht: „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.“ (Matthäus 5,6) Es geht also nicht um die Befriedigung von Bedürfnissen und auch nicht um das Grundbedürfnis von Essen und Trinken. Es geht um das höchste Verlangen, zu dem ein Mensch in der Lage bist: dass Gottes Gerechtigkeit die Welt satt macht. Damit ist die Marke gesetzt. Auf Gerechtigkeit hoffende und sie herbeisehnende Menschen sind ein Unruheherd für alle Machtspielchen, Gierereien und Ausbeutungen. Sie geben nicht auf, weil sie so nach Gerechtigkeit verlangen wie ein Verhungernder nach Wasser und Brot. Sie lassen sich mit nichts abspeisen oder vertrösten, mit keiner Süßspeise und keinem Bestechungsgeld und sei es noch so groß. Sie machen ihr Satt werden davon abhängig, dass Gottes Gerechtigkeit wirklich wird. Das ist kein egoistisches Verlangen. Sie tun es für die, die längst ihre Hoffnung und ihre Sehnsucht aufgegeben haben, weil sie im Einsatz für eine bessere Welt zermürbt worden. Sie tun es für die Kinder, die geboren werden, damit diese in eine Zukunft ohne Angst hineinwachsen. Sie tun es gegen die Verbrecher, die die Gerichte davon kommen lassen. Wer hofft und sich sehnt ist schon im Vorhinein satt. Das ist ein Geheimnis des Weges mit Hoffnung und Sehnsucht. Es gründet sich allein auf den, der Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt zur Geltung gebracht hat: Jesus Christus! Von ihm hat Gott gesagt: „Auf den sollt ihr hören!“
„Hans Arno Joachim und Freiburg“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
21.2.25
Wer eine Antwort auf die Frage sucht, wer ein Mensch sei, wird im heutigen Lehrtext fündig. Denn wie sollte eine Antwort einfacher und klarer ausfallen als dieser Ausruf: „Seht, welch ein Mensch!“ (Johannes 19,5) Es ist der mit allen Abwassern dieser Welt gewaschene Pilatus, der das Volk auffordert, Jesus als Menschen anzusehen. Wenn das ein Mensch sein soll, gefoltert, geschlagen, verspottet, verhöhnt und öffentlich zur Schau geführt – was sind dann die anderen? Menschen mit Masken. Verstellte Menschen. Menschen, die ihr wahres Gesicht verbergen. Die lachen, wenn ihnen zum Weinen zu Mute ist. Die lieber schauspielern, als zu ihren Gefühlen zu stehen. Die lieber abspalten, als sich zu versöhnen. Wenn Jesus der wahre Mensch ist, dann ist damit die offensichtliche Wahrheit ausgesprochen: wenn du so von Menschen zugerichtet bist, dann musst du dich geben, wie du bist. Dann nutzen dir Masken gar nichts mehr. Auch deine Herkunft, dein Geld, deine Titel – nichts, was du vorbringen könntest. Der wahre Mensch ist der komplett entblößte Mensch. Und so spiegelt sich in Jesu Schicksal auch das des Gottesknechts des zweiten Jesaja, von dem in Kapitel 53 gesagt wird: „Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet.“ Wenn das mitschwingt, dann ist der wahre Mensch derjenige, vor dem der Rest der Welt lieber die Augen verschließt, weil er nicht ihrem Ideal eines schönen und gesunden Menschen entspricht. Der unansehnliche ist der wahre Mensch. Es kommt ja noch hinzu, dass dieser Mensch der Sohn Gottes ist. Der Unansehnliche ist der Himmelsbote. Die Krone aus Dornen wird zum Offenbarungsort wie einst bei Mose. „Seht auf ihn!“ hören wir seinen Vater aus dem Himmel rufen. Gott will keinen anderen. Er will diesen einen. In ihm leuchtet die Wahrheit Gottes auf.
Es geht darum, sich von diesem dornengekrönten Gottesmenschen den Blick schärfen zu lassen für ein wahres, ehrliches Miteinander. Von Mensch zu Mensch geht richtig nur auf Augenhöhe. Doch wie schwer ist das inmitten des Gestrüpps von Eitelkeiten, Machtspielchen und Ehrenkäsereien.
„Franziska und politische Haltung“ auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
„daily basic – Welch ein Mensch!“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
20.2.25
Plötzlich landet man mitten in einem Propheten bei der Weisheit. Dabei denkt man doch, dass Propheten in die Zukunft sehen, was so nicht stimmen kann. Propheten sind „Hellseher“ auf eine andere Weise. In erster Linie sind sie Beobachter. Und zwar ohne Scheuklappen. Ihr scharfer Blick verschont niemanden. Liest man Texte der sozialkritischen Propheten wie Amos und Hosea hat man oft den Eindruck, dass sie einseitig sind und übertreiben. Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie jede Neutralität und Ausgewogenheit vermissen lassen, wenn es um soziale Missstände und den fehlenden Ausgleich in der Gesellschaft geht. Doch letztlich sind diese Propheten nur ihrem Gott verpflichtet, in dessen Hauptinteresse der Gerechtigkeit sie beobachten und kritisieren, mahnen und das Gericht ankündigen. So sehen sie klar, weil sie klarsehen und sich von nichts und niemand korrumpieren lassen. Ihre Hellsicht macht sie einsam in ihrer Umgebung. Doch gerade sie ermöglicht es ihnen, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Sie sehen nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen sozialer Ungerechtigkeit heute und dem Elend von morgen. Und sie mahnen, diesen direkten Zusammenhang meinen gefahrlos ignorieren zu können. Und dann ist – wie heute in der Losung zu lesen – Platz für eine Lebensweisheit: „So spricht der Herr: Treten hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! Aber sie sprechen: Wir wollen´s nicht tun!“ (6,16) Weisheit kommt durch Lebenserfahrung. Und beachtet man sie nicht, was sie einen lehren will, dann bleibt man eben dumm. Gott meint es gut. Er verweist das Volk an seine von ihm gesegnete Geschichte. Die Wege der Vorzeit: das sind die Segensgeschichten von Abraham, Isaak und Jakob, von Mose und Josua. Das sind die Wege der Bewahrung und Befreiung. Wege, die Gott sein Volk geführt hat wie ein Hirte seine Schafe. Da ist eine große Auswahl. Findet den guten Weg für euch, sagt Gott, und wählt ihn für euch jetzt aus. Und geht los! Was sich einst bewährt hat, kann für die Zukunft nicht das Falsche sein, zumal es ja ein Weg Gottes war und sein wird. Das zu tun, wäre weise. Insofern stimmt tatsächlich, was im Prediger Salomo steht: Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Doch die Angesprochenen lassen sich nichts sagen. Sie ignorieren. Sie spalten die Geschichte Gottes mit ihnen ab. Damit sind sie nicht nur dumm. Sie werden einen hohen Preis dafür bezahlen.
Das tun im Übrigen alle, die ihre eigene Geschichte oder Teile von ihr nicht wahrhaben möchten oder bewusst verleugnen. Sie werden ihre Gründe dafür haben. Doch an der Tatsache, dass sie sie abspalten, führt nichts vorbei. Sie sind verantwortlich für das, was sie tun.
„Die verpönte Lust“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
19.2.25
Nahezu unvermittelt ist die Liebe da. Bis ins 12. Kapitel hinein geht es im Römerbrief um den Glauben. Und auf einmal spricht Paulus von der Liebe: „Die Liebe sei ohne Falsch.“ (12,9) Er meint hier keine romantische Liebe, sondern die Achtung, den Respekt und die Fürsorge innerhalb der Gemeinde und den Menschen gegenüber. Diese Liebe ist vom Menschen unabhängig. Sie ist Gottes Liebe und er hat sie vom Himmel herab den Menschen in die Herzen gegossen (5,5). Sie steht wohlüberlegt am Anfang einer längeren Reihe von Ermahnungen, wie sich das Leben in der Gemeinde gestalten soll. Die Liebe sucht sich ihren Weg in die Herzen der Menschen und selbst, wo ein Mensch glaubt und gläubig ist, hat sie es dennoch schwer. Da ist viel anderes, was ihr den Weg versperrt oder gefährlich werden will. Denn diese Liebe hat nichts mit dem „Mantel der Nächstenliebe“ zu tun. Sie ist klar und deckt auf, heilt und sagt die Wahrheit. Versteckspielchen mag sie nicht. Sie ist hart gegen das Böse. Insofern ist sie die harte Währung, steht sie sonst in der Gefahr, unkritisch und schwach zu sein. Wenn die Liebe regiert, ist das Gesicht offen und der Blick frei und klar. Der Hass jedoch – auch gegen den ungeliebten Teil der eigenen Geschichte – liebt die Verschlossenheit. Im Urtext steht ein Wort, das verwandt ist mit „Maske“. Die Liebe aus Gott hat keine Maske nötig. Sie spielt offenes Spiel, sie sagt, ja sie ist die Wahrheit, denn sie kommt aus dem Herzen Gottes. Diese Liebe, sagt Paulus, sei nicht falsch, sondern demaskierend, sie wird den Geistern der Heimlichkeit, der Verdrehung und des Misstrauens auf den Leib rücken. Bei Geheimdiplomaten sucht man sie vergebens. Das Böse, sagt Paulus, kann man dank dieser Liebe hassen und dem Guten anhängen. Kompromisslos ist das. Ja oder Nein. Gegenüber dem Bösen ist sie unnachgiebig und unbequem. Sie will es vernichten, weil es nicht zu ihr passt. Das Böse hat neben ihr keine Duldung. Von Klaus von Flüe heißt es, er habe einmal einem hohen kirchlichen Würdenträger auf die Frage, was Geiz sei, geantwortet, das müsse er selbst am besten wissen, er habe ja letzthin 27 Kisten Wein spottbillig einem Winzer abgekauft und kurz danach zu überhöhtem Preis verkauft. Jesus hätte genauso geantwortet.
„Dekadenz und Römer 1“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscsast.fm
18.2.25
Jesus spricht zu seinen Jüngern als Freunde. Er eröffnet ihnen ein Geheimnis. Die Macht der Mächtigen bezieht sich lediglich auf den Körper. Den können sie quälen und töten. Mit dem Tod aber ist ihre Macht zu Ende. Über das, was dann kommt, haben sie keinen Zugriff mehr. Damit will Jesus seinen Freunden die Angst vor Mächtigen nehmen, die in keinem Verhältnis zu dem steht, der die entscheidende Macht hat, nämlich in der Welt nach dem Tod, in die Gehenna (Ort der Strafe; ursprünglich ein Tal nahe bei Jerusalem; später Hölle) zu werfen. Diesen Gott sollen sie fürchten. Damit geht Jesus aufs Ganze. Er stellt eine innere unauflösliche Beziehung her zwischen dem Bekennen zu ihm hier vor den Menschen und dem Erlöst werden nach dem Tod. Wer hier kneift, hat dort keine Chance. Konsequenter kann der Wert von Freundschaft hier wie dort nicht definiert werden. Zu ihm stehen – ohne Angst vor Menschen und in der freudigen Erwartung, dass es drüben Annahme und Vergebung gibt. Helmut Gollwitzer schreibt es so: „Ein Mensch steht im hellen Kreis der Engel schutzlos und das um ihn strahlende göttliche Licht klagt sein Leben auf den Tod an; da aber tritt in diese Verlassenheit unvermutet ein Freund, der auch hier so sehr sich und seine Freundschaft behaupten kann, dass der Richter an Stelle des Urteils die Vergebung spricht.“ Die Sünde wider Heiligen Geist, von der Jesus in diesem Zusammenhang spricht (Lukas 12,10), ist es, diesr göttlichen Macht weniger zu trauen als der Macht der Mächtigen. Hierdurch ergibt sich der direkte Zusammenhang zum heutigen Lehrtext: „Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt; denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt.“ (Lukas 12,11.12) Die Reichweite des Heiligen Geistes ist den Einschüchterungsversuchen der Mächtigen überlegen. Leicht gesagt! Ich weiß! Trotzdem gilt es. Ich glaube, dass Dietrich Bonhoeffer, tief verwurzelt in dieser Gewissheit, kurz vor dem Galgentod am 9.4.1945 im KZ -Flossenbürg deshalb sagen konnte: Das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang. Ein Getröstet sein, das sich die Nazi-Henker nicht erklären konnten.
„Barth und die Homosexualität“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
17.2.25
Der 1. Thessalonikerbrief ist der erste Brief, den Paulus geschrieben hat und somit auch das älteste Schriftstück des Neuen Testaments. Liest man ihn mit diesem Wissen, bekommt man einen Einblick in die Realität der frühen Christenbewegung. Auf seiner Griechenland-Mission hat Paulus mit Timotheus 49/50 n.Chr. die Gemeinde in Thessaloniki gegründet. Ein Jahr später schreibt er zusammen mit Timotheus und Silvanus seinen ersten Brief an diese Gemeinde. Später sollte noch ein zweiter folgen. Der Brief enthält zwei Themen: zum einen die Frage der Naherwartung und zum anderen die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Paulus. Die erste Frage entstand dadurch, dass die ersten Gläubigen verstorben sind. Damit hat man aber nicht gerechnet, denn man glaubte und hoffte, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Seine Glaubwürdigkeit als Verkündiger konnte Paulus dadurch unter Beweis stellen, dass er den ca. 30 Gläubigen nicht auf der Tasche lag und selber für seinen Lebensunterhalt gesorgt hat. Die Jesusgläubigen nannten sich ecclesia, eine kleine Gruppe, die sich in einem privaten Haus versammelte. Die meisten waren Pagane und sind konvertiert. Davon schreibt Paulus wie folgt (1,9): „…wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dem lebendigen und wahren Gott.“ Das war eine mutige und einschneidende Lebensentscheidung in einer Stadt wie Thessaloniki mit ihren 100.000 Einwohnern und einem reichen Spektrum an religiösen Angeboten wie dem Dionysoskult, Mysterienreligionen und umherziehenden Heilslehren, die den Leuten gesagt haben, wie sie gut leben und damit Geld gut verdient haben. Die Konversion war eine Hinwendung zum jüdischen Gott, dem Vater Jesu Christi. Es war die Abwendung von Göttern, die man sehen und anfassen konnte hin zu einem unsichtbaren Gott. Paulus erzählt den Jesusgläubigen, dass er in Philippi gelitten hat und misshandelt wurde und trotzdem den Mut fand, nach Thessaloniki zu gehen (Lehrtext 1. Thessalonicher 2,2 von heute).
Die soziologische Situation der Gemeinde in Thessaloniki und der heutigen Kirche ist nicht zu vergleichen. Möglicherweise nähert sich aber die heutige Kirche der Situation der ersten Gemeinden an. Die Frage von damals begleitet die Kirche durch ihre Geschichte: Wer sind wir? Was macht uns aus? Findet sie eine für sich gute Antwort, wird sie für die Menschen attraktiv sein. Zugleich muss Kirche auch die Frage nach der Glaubwürdigkeit derer gefallen lassen, die sie in der Öffentlichkeit vertreten.
„Ewald und Karl Barth“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
16.2.25
Predigt zu Prediger 7 auf dieser Homepage unter „Predigten“
15.2.25
Wer hat jemals behauptet, der nahe Gott könnte einem nicht auch ein fremder werden? Wer wäre jemals so kühn gewesen? Wer denkt, die Nähe Gottes so glauben zu können, dass sich Gott ihm nicht auch mal entzieht? Wer? Die Worte der heutigen Losung geben einen tiefen Blick in das verzweifelte Innere eines Menschen: „Mein Gott, des Tages rufe, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.“ (Psalm 22,3) Bei Psalm 22 klingelt´s sofort. Er beginnt so: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Ein Jude, der am Kreuz verreckte, hat mit seinem Blut und Leiden diese Worte des Psalms 22 zu heiligen Klageworten in die Welt hinausgeschrien. Persönliche, zu tiefst persönliche Worte. Er wäre nicht der Erlöser, wenn er es nicht erlauben würde, dass alle, die unschuldig leiden, weggeschoben und verachtet werden, sich in diesem Schrei alter Worte wiederfinden dürfen. Es scheint – der Schrei ist heute noch nicht laut genug. Oder die Ohren derer, die ihn hören sollten, sind auf Durchzug gestellt. Der am Kreuz hat den fremden Gott erlebt – seinen Gott. Er schweigt. Er antwortet nicht. Der nahe Gott ist fern. Wenn dir etwas Fremdes begegnet, hast du zwei Möglichkeiten: du machst es dir zum Feind oder zum Freund. Dazwischen gibt es nichts. Dabei kann gerade das, was fremd klingt, neues Verstehen ermöglichen. Man kann es auch wie Hannah Arendt verstehen. Sie spricht von Natalität. Es wird ein neues Verstehen geboren. Fremd sein kann auch fremd bleiben. Dadurch wird es keineswegs bedrohlich. Von dem Juden Hans Arno Joachim ist folgendes Gedicht überliefert: „Gepriesen sei der Gott meiner Väter nach langer Zeit. Gelobt sei der Gott meiner Großväter, den sie nannten, Schöpfer Himmels und der Erden. Auch genannt von ihnen: König, ihr Schild und ihrer Väter Schild. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jacobs. Gelobt und gepriesen nach langer Zeit, – auf neue. Gelobt sei der Herr, König und Gott des Herrn Rabiner Aron Roos und der Frau Rabiner Roos, des Rabiner Kaufmann Reis und Frau, geborene Roos. Gott von Synagogenrath Reis und Frau Henriette, geborene Mirils. Gott von Samuel Joachimzcsyk, begraben in Zerkow. Gelobt sei er, Gott der Roos und der Joachimzczsyks, Gott von Dr. med. Hermann Joachim und Frau geborene Roos, mit der er zeugte den Dr. Kurt Joachim und mich, Hans Aron Joachim, Schriftsteller, der sich Deiner erinnert, mein Gott, zu Freiburg, einer Stadt, welche gelegen ist an drei Quellen und nun mehr ein Fremdling geworden ist im Lande Deutschland, wie es seine Großväter waren in Ägypten und seine Väter in Babylon. Und spricht von Dir, lieber Gott in Schmieheim und in Alt-Breisach, lieber Gott in Posen und in Jarozin, lieber Gott in Freiburg und in Paris.“
Ich füge zum Schluss den Vers 4 aus Psalm 22 hinzu: „Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.“
„Hochmut aktuell“ am 15.2.25 auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
14.2.25
Sie klingen wie aus einer fremden Welt. Es wird ein Mensch beschrieben, der völlig aus dem Raster fällt. Er ist keine normale Existenz. Er passt in keine Schublade. Er ist ein Fremder in seiner Welt. Ich spreche von Liedern, die von ihm singen. Es sind die sog. Gottesknechtslieder im zweiten Jesaja (40-55). Jerusalem wurde 587 v.Chr. von den Babyloniern erobert und zerstört. Der Tempel wurde geschleift und die heiligen Geräte nach Babylon gebracht. Die Bevölkerung musste den Weg in ein über 50 Jahre dauerndes Exil antreten. Alles kaputt! Auch die Hoffnung? Auch der Glaube? Mag sein! Aber die Erinnerung kann niemand kaputt machen. Aus ihr entstehen nämlich in schweren Zeiten Hoffnung und Glaube. So auch bei den Exilierten. Auch wenn ihr Gott verhöhnt und verspottet wurde. In ihrem Inneren hielten sie an ihm fest, auch wenn es schwer war. Im Gottesknecht des Zweiten Jesaja kann man die Zerschlagenheit der Exilierten erkennen und die Hoffnung, die sich in ihm widerspiegelt, wenn es im 1. Lied heißt: das Geknickte wird er nicht brechen und das Glimmenden nicht auslöschen. Das ist kein Himalaya an Hoffnung. Aber wenigstens ein kleiner Hügel. Aus dem letzten Lied ist die heutige Losung: „Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet.“ (53,3) Die weiteren Liedstrophen haben Eingang gefunden in die Karfreitagsliturgie. Die ersten Jesusgläubigen haben in diesen Liedern Jesus als unschuldig Leidenden entdeckt. Sie waren ihnen Verstehens- und Sprachhilfe.
Die ist sie auch heute noch. Und doch bleibt die Frage: Wer war dieser Gottesknecht wirklich?
„Vom Hochmut zur Demut“ am 14.2.25 auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
auch gut zu hören: https://tagesimpuls.letscast.fm
13.2.25
Es ist eben noch nicht aus und vorbei. Jeremia prangert an, was Gott ihm aufträgt: Gier, Lügen, Oberflächlichkeit, belangloses Reden, fehlende Glaubwürdigkeit von Würdenträgern wie Priester und Propheten. Das hört sich schlimm an, doch Gott sieht weiter. So hört sich denn die heutige Losung aus dem Propheten Jeremia so an: „Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele!“ (6,16) In der Tiefe also des toxischen Zustands der damaligen Gesellschaft stellt Jeremia einen Mangel fest. Sie ruht nicht in sich. Sie ist entwurzelt. Sie rast und hetzt, sucht und verirrt sich. Sie hat die Orientierung verloren. Und meint doch, auf dem richtigen Weg zu sein. Doch in der Tiefe, im Unsichtbaren, ist die Gesellschaft an sich selbst verloren, an eine Unruhe, die alle in ein Hamsterrad schickt. Ruhe ist ein wichtiger Wert, ja vielleicht der höchste im Judentum. Es ist der Schabbath. Ein Ruhen nach getaner Arbeit. Ein Ausruhen als ein sich besinnen auf gegangene Wege. Die heutige Losung ist also ein seelsorglicher Rat an die rastlosen Menschen, vielleicht sogar ein therapeutischer. Beginnt mit dem Aufhören. Hört nicht nur euch selbst reden. Hört auch mal den anderen zu. Fragt mal nach statt immer zu meinen, als besser zu wissen. Fragt nach, was früher war. Der zweite große Wert im Judentum ist das Erinnern. Und das beginnt mit einer Frage beim Sedermahl. Der Jüngste fragt: Was unterscheidet diese Nacht von den anderen Nächten des Jahres? Und dann wird von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten erzählt. Das Erzählen lässt die Zeiten zusammenfallen. Im Erzählen bin ich dann der, der versklavt war und befreit wurde. Das ist es, was Gott empfiehlt. Haltet inne und fragt zurück in eure segensreiche Geschichte und überlegt, welcher Weg von damals für euch heute in Frage kommt. Es gibt einen. Ihr müsst ihn nur suchen. Und dafür müsst ihr innehalten und still werden. Macht das doch! Es wird euch gut tun. Der frühere Weg, den ihr entdeckt, wird der künftige sein. Das wird euch nicht nur beruhigen. Das wird euch Ruhe verschaffen, weil ihr wegkommt davon, alles neu erfinden zu müssen.
Auch für uns Heutige eine wichtige Aufforderung. Welcher Weg in deiner bisherigen Lebensgeschichte war gut? Wenn du nachdenkst, achte auf die Resonanz auf deinem Erinnerungsweg. Wo das Herz höherschlägt, wirst du Ruhe finden.
„Hochmut erzählt“ am 13.2.25 auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Eckhard und der Irak“ Interview mit Pfarrer i.R. Eckhard Weissenberger auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
auch gut zu hören: https://tagesimpuls.letscast.fm und https://buchgenuss.letscast.fm
12.2.25
Der sog. „faule Friede“ hatte schon immer Konjunktur. Heute sowieso und hört man sich die heutige Losung aus dem Propheten Jeremia an, dann weiß man, dass er seine Spuren in der Geschichte der Menschen hinterlassen hat. Das Gotteswort heißt: „Sie gieren alle, Klein und Groß, nach unrechtem Gewinn, und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur oberflächlich, indem sie sagen: Friede! Friede!, und ist doch kein Friede.“ (Jeremia 6,13.14) Mit dem „faulen Frieden“ ist es nicht getan. Erschreckend ist dieses: Klein und Groß sind gierig. Das ist fatal, nicht nur wegen der Gier. Es ist deshalb fatal, weil sich hier herausstellt, dass die Kleinen von den Großen gelernt haben, gierig zu sein. Als wäre es normal, gierig zu sein. Was sollen die Kleinen auch machen? Sie machen, was ihnen die Großen vormachen. Gott zählt hier alle die Sachen auf, die eine Gesellschaft zu einer toxischen machen: Gier, Betrug, Lüge, Oberflächlichkeit, Worthülsen. Schlimmer geht es nicht. Ich kann nicht umhin, mal zu fragen: Wie fiele Gottes Analyse unserer momentanen Gesellschaft aus? Ich kann verstehen, wenn in Freiburg am Montag gegen die AfD-Wahlveranstaltung demonstriert wurde. Als ich eine kurze Aufnahme auf meinem Whatsapp-Status ansah, bin ich erschrocken. Die Menge schrie: „Ganz Freiburg hasst die AfD!“ Bin ich nicht einverstanden! Hass ist keine Meinung. Hass ist eines der stärksten negativen Gefühle, zu denen ein Mensch in der Lage ist. Dieser Ruf macht mir Angst, egal von wem er kommt. Was hält eine Gesellschaft zusammen? Ein Punkt schmerzt Gott offenbar sehr. Dass nämlich seine Vertreter ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Seine Priester und seine Propheten sind zu moralischen Leichtgewichten geworden. Sie schaden statt zu heilen. Ihre Worte sind hohl, ohne heilende Wirkung und Tiefgang. Sie sollen das Volk leiten, doch ihr verlogenes Reden und Tun geben sie als Wahrheit aus. Das ist pervers! Gott ist zurecht nicht nur empört, sondern zornig. Er hat nur die Möglichkeit, seinen einzigen ihm verbliebenen Getreuen Jeremia zu beauftragen, diese Verdorbenheit seiner Führungselite anzuprangern. Die ruft immerzu „Friede! Friede!“ und meint „Friede-Freude-Eierkuchen“. Was den Frieden angeht, gehen die Meinungen heutzutage ziemlich auseinander. Wer ständig von ihm spricht, macht ihn inflationär. Der Schalom ist im Eigentlichen ein Wohlsein an allem. Ein Gutsein in allem. Ein ruhiges, genussvolles Leben führen dürfen. Keine Bedrohung. Friede gibt es ehrlicherweise nur so und nicht parteipolitisch auf Linie gebracht.
„Hochmut in der Bibel“ am 12.2.25 auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Eckhard und der Irak“ Interview mit Pfarrer i.R. Eckhard Weissenberger auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
auch gut zu hören: https://tagesimpuls.letscast.fm und https://buchgenuss.letscast.fm
11.2.25
Es muss, ja es soll gerecht zu gehen in der Welt und zwischen den Menschen. Da wird niemand widersprechen. Doch wenn es konkret wird, gehen die Meinungen weit auseinander. Denn bei „gerecht“ denken wohl die Wenigsten an das Recht als vielmehr an die Gerechtigkeit. Aber wie sehr ein Gerichtsurteil Menschen enttäuscht kann, sieht man oft daran, dass sie fragen: „Und wo bleibt die Gerechtigkeit?“ Das kann ihnen niemand beantworten, denn die Gerechtigkeit ist und bleibt ein so hohes ethisches Gut, dass es nur partiell in Gesetzestexten und Gerichtsurteilen durchscheint. Man meint geradezu, dass jeder Mensch auf dieser Welt von Geburt an ein Gefühl dafür mitbekommen hat, was Gerechtigkeit bedeutet. Und an oberster Stelle steht wohl das Gefühl, dass nur Gerechtigkeit es schafft, Menschen durch einen Ausgleich zusammenzuhalten. Wo also Unrecht und Übervorteilung um sich greifen, wird es den Menschen zu bunt und sie gehen auf die Straße und streiken. Nicht alle, die schreien, haben recht. Doch ein Schrei hat immer eine Kernbotschaft und die gilt es wahrzunehmen. Möglicherweise ging der heutigen Losung auch ein Schrei voraus. Da wird eine Praxis angeprangert, die man fast nicht glauben kann. Der Text aus dem Buch Leviticus lautet: „Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht: du sollst den Geringen nicht bevorzugen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten.“ (3. Buch Mose 19,15) Das ist recht gesprochen. Das ist fortschrittlich. Das steht irgendwie quer, weil man doch fühlt: wenn man schon jemandem den Vortritt lassen soll, dann doch der Person mit dem geringeren gesellschaftlichen Status. Nichts da!, sagt die Thora. Sie will alles vermeiden, das Aufruhr und Schieflage hervorbringt. Das geschieht eben auch dann, wenn man jemanden einem anderen vorzieht. Die Situation in einem Gerichtsverfahren verschärft diesen Gedanken noch. Zugleich gilt auch: die Großen, also die Begüterten, sollen ebenso wenig begünstigt werden wie der Mensch niederen Status bevorzugt werden soll. Das nenne ich mal „Kein Ansehen der Person“. Ich ziehe den Hut vor den Leuten, die sich auf diese Rechtsbestimmung geeinigt haben. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Sie ist 2600 Jahre alt. Eine Rückbesinnung tut gut und ist vonnöten – gerade in der Steuerpolitik.
„Eckhard und der Irak“ Interview mit Pfarrer i.R. Eckhard Weissenberger auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
„Angesagt: Hochmut!“ eine Episodenreihe vom 12.-16.2.25 auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
10.2.25
Da wird Hiob uns zum Vorbild, wenn er sagt. „Bei Gott ist Kraft und Einsicht. Sein ist, der da irrt und irreführt.“ (Hiob 12,16) Diese zwei Sätze stammen aus der ersten Antwort des Hiob an seinen Freund Zofar. Es wäre ein Irrtum zu meinen, Hiob würde Gott verteidigen. Das liegt ihm fern. Denn in seinem Widerspruch zum religiösen Tröstungsmodell seiner drei Freunde, verschont er Gott nicht mit Vorwürfen und Beschimpfungen. So sagt er zu ihm „Schuft“ und „Du quälst mich und deine Geschöpfe. Ist dir langweilig? Hast du nichts Besseres zu tun?“ Hiob schont auch seine Freunde nicht, weil sie ihn nicht schonen. Es ist eh eine Ungleichheit in dieser Begegnung. Drei gegen eins. Das ist deshalb so ungleich, weil die Freunde im Grunde mit einer Stimme reden. Wenn einer spricht ist es, als sprächen die anderen beiden auch. Hiob muss sich also dreifach zur Wehr setzen. Warum muss er das? Die Freunde wollen ihm einreden, dass sein Leiden in ihm selbst eine Ursache haben muss. Sie wollen ihn dahinbringen, dass er eine Schuld entdeckt, bereut und bekennt und dann wird Gott ihm wieder Gutes tun. Hiob macht da aber nicht mit. Er glaubt felsenfest, dass er an seinem Elend keine Schuld hat und dass er deshalb auch nicht büßen muss. Er macht Gott für sein Elend verantwortlich. Wenn schon, dann liegt also die Ursache bei ihm. Da weder die Freunde noch Hiob von ihrer Sichtweise abrücken, kommen sie nicht zueinander. Und man könnte fragen: Ja, wie ist das jetzt mit dem unschuldigen Leiden? Jedes Leiden hat den Charakter von Unschuld. Leiden ist wohl das Einfallstor für Grübeleien und Selbstvorwürfe. Letztlich ist es aber nicht zu ergründen. Wenn das so ist, dann öffnet das Leiden das Tor zum Klagen (man denke an die Klagepsalmen). Und Hiob treibt die Klage in der Anklage auf die Spitze. Und am Ende wird er recht behalten. Aber nicht aus Eigensinn. Gott gibt ihm in allem recht. Am Ende des Hiobbuches spricht Gott zu Elifas: „Mein Zorn ist entbrannt über dich über und über deine beiden Freunde; denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob…Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun; denn ihn will ich erhören…Ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob.“ (42,7.8) Bedenkt man die Losung für den heutigen Tag, dann kann man gerne Bonhoeffer bemühen, der gesagt hat, dass zwischen den Glaubenden und seinem Gott kein Blatt passen darf. Hiob hat es vorgemacht – gegen alle Widerstände. Und die kamen von seinen Freunden.
Das Gespräch zwischen den drei Freunden und Hiob habe ich auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm in der Episode 41a „Ewald und Hiob“ ausgeführt.
Wochenthema „Hochmut“ vom 11.-15.2.25 auf https://tief-glauben-weit.denken.letscast.fm
9.2.25
Endlich Sonntag! Der Sonntag ist nach christlichem Verständnis der erste Tag der Woche. In der christlichen Tradition beginnt also die Woche mit einem Feiertag. Kern des Sonntags ist die Botschaft von der Auferweckung Jesu von den Toten. Deshalb wird der Sonntag in anderen Ländern auch „Tag des Herrn“ genannt. Die Tage, die dem Sonntag folgen, beziehen sich auf die entscheidenden Tage im Leben Jesu. So ist der Donnerstag der Gründonnerstag („grün“ kommt von „greinen“, was „weinen“ oder „klagen“ bedeutet), der Freitag ist der Karfreitag und der Samstag ist der „stumme Tag“, der Tag des Schweigens, der in den Osterjubel mündet, in den die Gemeinde am Sonntag einstimmt. In Bahlingen wird um zu einem 10:00 Uhr ein Familiengottesdienst und um 18:00 Uhr zur „Auszeit im Chorraum“ eingeladen. Und hier der Bibeltext (Markus 4,35-41), der beiden Gottesdiensten zugrunde liegt:
Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns ans andre Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind!
„4 Elemente der Resonanz“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
8.2.25
Die Losung für den heutigen Tag („Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr!“ Psalm 111,4) führt in die Welt des 111. Psalms. Im Kreis von Tempelbesuchern preist der Psalmist Jahwes große Geschichtstaten. Er spielt an die Speisungswunder an während des Wüstenzugs in Vers 5, auf die Übergabe des verheißenen Landes an die eingewanderten Stämme Vers 6 sowie die Gabe des Gottesrechts Vers 7. Dieses macht nur Sinn, wenn es auch befolgt wird V 8. Das Land ist aber nur zur Nutzung geliehen. Es findet kein Eigentumswechsel von Gott zu Israel statt. Das ist in 3. Mose so geregelt: „Grund und Boden dürfen nicht für immer verkauft werden, denn das Land gehört mir, und ihr seid Fremde und Beisassen bei mir, spricht Gott.“ Bodenspekulation ist also verboten in Israel. Nur selten ist deshalb in der jüdischen Bibel vom „Land Israel“ die Rede, denn es ist Gottesland. Eine gewisse Anzahl an Bibelstellen beziehen den Begriff nur auf Nordisrael. Israel hat also keinen Rechtsanspruch auf das Land, empfing dieses vielmehr von Gott als geliehenes Land. Wie muss von hier aus die Siedlungspolitik der aktuellen Regierung Israels gesehen werden? Naim Stifan Ateck drückt es so aus: „Nicht das Land bringt dem Volk Segen, sondern das Vertrauen auf den Gott des Rechts, der Gerechtigkeit und des Erbarmens.“ Er vertritt unaufhörlich die Rechte der Gebeugten, Unterdrückten und Verfolgten. Jahwes große Taten werden im Tempelkult ständig vergegenwärtigt. Durch erzählendes Erinnern wird Geschichte zur Gegenwart. Die Haggada schreibt vor: „In jeder Generation betrachte sich der Mensch, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen.“ Sich Gott zuwenden bedeutet, dass die Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft füreinander durchlässig werden. Der Psalm 111 endet weisheitlich: „Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn.“ Abraham Heschel sagt es so: „Im Judentum ist die Gottesfurcht oder die Ehrfurcht vor dem Himmel fast gleichbedeutend mit dem Wort Religion.“ Das Gott Fürchten drückt Gert Otto mit dem Begriff mysterium tremendum aus. Etwas von diesem Erzittern, Erschaudern ist in V 9 spürbar. Dort heißt es: „Heilig und furchtbar ist sein Name.“ Hans Jonas sagt dazu: „Der verborgene Gott ist eine zutiefst unjüdische Vorstellung. Unsere Lehre, die Thora, beruht darin und besteht darauf, dass wir Gott verstehen können, nicht vollständig natürlich, aber etwas von ihm, von seinem Willen, seinen Absichten und sogar von seinem Wesen, denn er hat es uns kundgetan.“ Abraham Heschel sagt, dass die Ehrfurcht das Gegenteil von Furcht sei. So wagt Hermann Cohen sogar ein neues Verb: ehr-fürchten. Ehrfurcht ist nach Heschel ein „Akt der Einsicht in einen Sinn, der größer ist als wir selber…Der Anfang der Ehrfurcht ist das Staunen, und der Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht.“
Ich durfte am 4. Februar Franziska Eick kennenlernen. Sie ist Frauenärztin in Endingen und Enkelin des Widerstandskämpfers Fabian von Schlabrendorff. Ihre Mutter ist eine Großcousine von Maria von Wedemeyer, mit der Dietrich Bonhoeffer verlobt war. Im Interview am 8.2. auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm erzählt Franziska Eick, wie das Vermächtnis ihres Großvaters sie ermutigt, eine klare politische Haltung einzunehmen. Die Geschichte Fabian von Schlabrendorffs erzähle ich am 8.2. auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
7.2.25
Die Losung für den heutigen Tag („Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir.“ Psalm 63,2) legt eine nähere Betrachtung von Psalm 63 nahe. Es geht um David, der auf seiner Flucht vor Saul Zuflucht in der Wüste sucht. Not und Bedrängnis haben ihm den Durst nach Gott geweckt, konkret: nach seiner Nähe, nach seinem Schutz. So heißt es auch in Psalm 42: „Meine Seele dürstet nach dir!“ (V 2) David in Psalm 63: „Mein Körper schmachtet nach dir wie dürres lechzendes Land ohne Wasser.“ (V 2) – wie die Wüste also, in die David hat fliehen müssen. Leiblicher und seelischer Durst geben sich die Hand. Was hier als „Seele“ übersetzt wird, heißt im Hebräischen „nefesch“. Und das bedeutet im eigentlichen Sinn die ganze individuelle Existenz. Kein Leib-Seele-Dualismus! „Die Scham, im Körper zu sein“ (Elisabeth Moltmann-Wendel) ist hebräischem Denken fremd. Diese bildet sich erst im hellenistisch-dualistischen Denken aus, von da aus ins Spätjudentum und ins nachbiblische Christentum. Eine Rückbesinnung auf das ganzheitliche Menschenverständnis der Bibel tut gut und not. „Wer an seinem Körper vorbeisieht, sieht an Gott vorbei.“ (Moltmann-Wendel) Der jüdische Philosoph Emmanuel Lévinas meinte: „Womit wird geglaubt? Wie die Psalmen sagen: mit dem ganzen Körper.“ Durst nach Gott! Der Beter verbringt – zusammen mit seinen Feinden (V 10)? – die Nacht im Tempel (V 7). Und dann ein starkes Bild in Vers 9: „Meine Seele haftet (=klebt) an dir, deine Rechte hält mich.“ Bedenkt man die Ganzheitlichkeit, die hier wieder bei „Seele“ zu bedenken ist, dann könnte dieses Bild fast schon als eine Vorwegnahme der erotisch-sexuellen Metaphern anmuten, wie sie christliche Mystikerinnen und Mystiker später gewagt haben. Jedenfalls bringt es höchst anschaulich die rettende Bindung der eigenen und geschwächten Vitalität an Gottes Stärke zum Ausdruck. Das „Haften“ verdankt sich ohne Zweifel der „Rechten“ Gottes. Sie ist es, die hält, bergend festhält! Die Haftkraft geht von Gott aus, das Haften des Betenden erwidert sie. Glauben heißt demnach: Haften, Kleben an Gott, der rettenden Zuflucht. Der jüdische Dichter Chaim Nachmann Bialik sagte: „Krallen hat das Los mir nicht gegeben. Meine Kraft ist Gott: Und Gott ist Leben.“ Doch den Angstmachern muss das Handwerk gelegt werden (V 12).
Ich hoffe, du kannst dich in diesen alten Worten wiederfinden und hast eine gewisse Lust bekommen, dich an Gott „kleben“ zu wollen.
„Resonanztanz Jesaja 42,3“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscsast.fm
„Hartmut Rosa, Demokratie braucht Religion“ auf https://buchgenuss.letscast.fm
6.2.25
Einem krassen Entschluss gingen noch krassere Ereignisse voraus. Da war zum ersten das Greifen nach der Frucht in Paradies, also ein Tabubruch, dann die Bruderfeindschaft zwischen Kain und Abel, also der erste Mord und das Ansteigen von Bosheit weltweit. Da ist Gott offensichtlich so erschrocken, dass er sich was ausdenken musste. Er entschloss sich aber nicht für Tabularasa, sondern für eine Reinigung. Er stand nach wie vor zu dem, was er geschaffen hat. Aber so wie es sich entwickelt hat, war es eben nicht in seinem Sinn. So wird erzählt, dass er letztlich gezwungen war, eine große Flut aufkommen zu lassen, die das Böse mitsamt den Bösen wegspült. Doch dachte er offenbar schon an die Zeit danach, denn sonst hätte er nicht ein Auge auf Noah, seine Familie und die unschuldige Tierwelt geworfen. Gott rettet – und das muss man festhalten – die in seinen Augen Unschuldigen – Noah mit seiner Familie und die Tiere. Es gab also Menschen, die Gott gefallen haben, weil sie in seinem Sinn gelebt und gehandelt haben. Das sollte man in der heutigen Rundumtheologie („Gott hat alle lieb!“) mal bedenken. Noah heißt übersetzt „Trost“. Ich habe das immer auf ihn selbst, die Familie und die Tiere bezogen. Mittlerweile beziehe ich diesen programmatischen Namen auf Gott. Noah hat ihn getröstet. Wenigstens auf diesen Einen kann ich mich verlassen!, höre ich Gott sagen. Und dann kam die Flut, die unverdorbene Kreatur überlebte in der Arche. Und offenbar hat Gott dann mal weggesehen von der Flut und seiner Wut und sich an Noah erinnert. Und dieser Blickwechsel hat in Gott etwas bewegt. Er ließ einen Wind über die Erde wehen, der die Fluten vertrieb (1. Mose 8,1). Da sind wir nicht mehr weit weg von der heutigen Losung (1. Mose 8,21). Denn was tat Noah als erstes nach dem Austritt aus der Arche? Er baute Gott einen Altar und opferte (1. Mose 8,20). Opfern ist als ein Annähern an Gott zu verstehen. Das heißt, Noah suchte als erstes die Nähe zu seinem Gott. Und der ließ sich erweichen und zeigte Reue. Jetzt sind wir bei der Losung für heute angekommen: „Der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf…Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1. Mose 8,21.22). Damit hat sich Gott rückgebunden an das, was er erschaffen hat.
Es kann also helfen, mal den Blickwinkel zu ändern! Gott hat es vorgemacht. Und wenn von ihm gesagt wird, dass er sich der Reue nicht verschloss, kann man über hochmütige Menschen nur den Kopf schütteln!
„Resonanztanz!“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Hartmut Rosa, Demokratie braucht Religion“ Buchvorstellung auf https://buchgenuss.letscast.fm
5.2.25
An diesem Wort Jesu komme ich nicht vorbei: „Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“ (Johannes 15,13) Um das vorneweg zu sagen: die Liebe, von der Jesus spricht, ist die sich hingebende Liebe, also die Liebe zum Nächsten, die Agape. Hingabe ist sie, nicht Opfer. Jesus spricht hier von einem Menschen, der nicht anders kann, als sein Leben für seine Freude hinzugeben. Jetzt fragt man sich: Wen meint er? Will er seine Freunde auf harte Zeiten einschwören? Hat er vielleicht Petrus vor seinem inneren Auge, der das Gegenteil getan hat? Oder Judas? Die Antwort erschließt sich aus den Worten, die folgen: „Ihr seid meine Freunde.“ (15,14) Jesus ist also der, der seine Freunde so liebt, dass er (im Notfall) mit seinem Leben für sie einstünde. Inniger und konsequenter kann man nicht lieben, als dass man das Leben der Freunde als so bedeutsam hält, dass man es als dem eigenen Leben gleichwertig erachtet. Leben für Leben. Untrennbar verbunden. „Ich gebe mein Leben, damit du am Leben bleibst.“ So spricht ein Erlöser. Dieser unbedingten Innigkeit geht die Bildrede vom Weinstock und den Reben voraus (15,1-8). Jesus vergleicht sich darin mit dem Weinstock und seine Freunde mit den Reben. Wenn ich durch die Weinberge hier am Kaiserstuhl laufe, wird mir das immer wieder klar: Nachfolge besteht darin sich bewusst zu machen, dass man aus der Lebensenergie Jesu lebt. Es gibt kein Tun eines Freundes Jesu, das nicht aus seiner Energie herauskäme. Und dennoch legt Jesus großen Wert darauf, dass seine Freunde tun, was er ihnen zu tun aufgibt. Ein sanftes Wellnesschristsein hat da keinen Platz. Es geht darum, aus der Energie Jesu den Früchten freien Lauf zu lassen und sich nicht bequem im Glauben einzurichten, so als könne man sich seines Glaubens erfreuen, ohne ihn den Härten des Lebens auszusetzen. Liebe im Sinne Jesu ist immer Liebe, die den Nächsten im Blick hat. Sie ist kommunikativ, nicht egoistisch. Die Liebe, also die Agape, ist das Band, das alle Freunde Jesu untereinander zusammenhält (14,12). Diese Liebe muss sich im barmherzigen Umgang miteinander zeigen. So jedenfalls hat es Jesus seinen Freunden aufgetragen (14,12).
VORSCHAU: vom 6.-9.2.25 wird getanzt auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Da ist einer barmherzig.“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm (Episode 48)
„International!“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm (Episode 47)
„Zwischenruf: Worte!“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm (Episode B)
4.2.25
Ich hatte erst gar keine Lust, irgendwas zum heutigen Lehrtext aufzuschreiben. Er heißt: „Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens.“ (Hebräer 4,12) Ich hatte einfach erst mal keine Lust, mich diesem martialischen Wort zu stellen. Vielleicht deshalb, weil ich zuerst über das Wort „Wort“ gestolpert bin. Es schwirren mir in Kopf und Herz noch die schrillen Wortfluten der vergangenen Woche. Vorwürfe, Vorhaltungen, Beleidigungen, Rechthabereien, Empfindlichkeiten. Nein! Das war kein Kindergarten. Das war im Bundestag. Worte sind das Schärfste, das ein Mensch hervorbringen kann, wenn er nicht bewaffnet ist mit Messer oder Pistole. Worte können so scharf sein, dass ein Mensch innerlich verblutet. Sie können ein Gewicht haben, dass das Gegenüber für immer in den Abgrund gezogen wird. Worte drücken aus, was in einem Menschen an Haltung und Überzeugung herangewachsen sind. Wenn es so weit ist, kann er es für ich behalten oder eben rauslassen. Zurückhaltung war nicht gerade die oberste ethische Norm letzte Woche im Bundestag. Irritiert, fast schon verwirrt und auch ein Stück weit traurig über so viel Wortflut wandte ich mich dann doch diesem anderen Wort zu, das mich seit ich denken kann, trägt, tröstet, korrigiert und Mut macht. Und ich konnte nur noch mit dem Kopf nicken: Ja, dieses Wort des lebendigen Gottes ist energisch bzw. voller Energie. Es ist hyperscharf, schärfer geht nicht – wie ein Schlachtmesser (so steht es im Urtext). Es fährt durch und durch. Es bringt hervor, was gedacht und gefühlt wird. Das macht mir keine Angst. Es tröstet mich. Ich habe letzte Woche so viel gehört, was ich nicht verstanden habe im öffentlichen und vertrauten Raum. Manches hat mich gefreut und Vieles traurig gemacht. Ich würde gerne dagegen gehen und vom Gegenteil überzeugen wollen. Aber das überfordert mich. Und ich komme jetzt vom heutigen Lehrtext her. Ich nehme dieses Wort ernst und mir wird klar: Ich muss nichts machen. Ich darf vielleicht möglicherweise gar nichts machen. Es ist mir nicht erlaubt, ins Innere eines Menschen mit meinen Worten einzudringen. Es ist gut für mich, Abstand zu halten. Die Klärung bei meinem Gegenüber wird ein anderes Wort herbeiführen, dessen Wirkung mein Wort bei weitem übersteigt. Der Hebräerbrief ist da glasklar in seiner Aussage. Dem heutigen Lehrtext geht eine Passage voraus, in der es um die Ruhe (Schabbath) geht bzw. darum, dass man zur Ruhe geführt wird. Das Wort – das wird durch 4,2 klar – ist das gepredigte Wort, also Menschenwort aus Gottes Wort hervorgegangen. Genaugenommen also keine schneidige, sondern eine schneidende, gar einschneidende Predigt (=verkündigenden Worte). Die haben ein Glück, denen eine solche Predigt zuteil wurde und wird. Denn geht sie durch Mark und Bein, hat sie Klärung gebracht. Und wo das geschehen ist, da kehrt innerer Frieden ein.
auch als „Zwischenruf: Worte!“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Gesalbte Rivalen – Saul und David“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
3.2.25
Esra und Nehemia werden im Alten Testament als zwei Bücher wahrgenommen. Jedoch müssen sie als ein Buch gelesen werden. Hieronymus spricht in der lateinischen Übersetzung des Alten Testaments (Vulgata) von Nehemia als 2. Esra. Mit den beiden Büchern der Chronik bilden Esra und Nehemia das Chronistische Geschichtswerk. Die Zeit der beiden Bücher ist die nach dem babylonischen Exil. Der Fall Jerusalems im Jahr 587 v. Chr. und die anschließende Deportation eines Großteils der Bevölkerung bedeuteten den Untergang des Südreichs Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Der Tempel war zerstört worden und die heiligen Geräte wurden nach Babylon geführt. Knapp 50 Jahre später unterwirft der Perserkönig Kyros im Jahr 539 v. Chr. das Babylonische Reich. Noch im selben Jahr erlässt er ein Edikt, das den Exilierten die Rückkehr nach Juda ermöglichte mit dem erklärten Ziel, in Jerusalem den Tempeldienst neu einzurichten (Esra 1,2-3). Auf seine Anordnung hin kehrte 539 eine erste Gruppe von Judäern nach Jerusalem zurück und baute dort unter größten Schwierigkeiten den Tempel wieder auf. Darüber berichten die Kapitel 1-6 von Esra. Erst rund 80 Jahre später kommt eine zweite Gruppe von Judäern nach Jerusalem. Sie wird geführt von dem Priester und Schriftgelehrten Esra, der im Auftrag des Perserkönigs Artaxerexes (465-424 v. Chr.) für den ordnungsgemäßen Vollzug des Opferdienstes sorgen und das Leben nach dem Gesetz des Moses (Thora) ordnen soll. Ein besonderes Anliegen ist es für Esra, den Eheschließungen von Judäern mit andersgläubigen Bewohnern des Landes ein Ende zu machen, um auf diese Weise das Volk Gottes rein zu erhalten. Darüber berichten die Kapitel 7-10. Dreizehn Jahre nach Esra erlaubt der Perserkönig einem sehr hoch gestellten Hofbeamten, dem Judäer Nehemia, nach Jerusalem zu gehen, und versieht ihn mit den Vollmachten eines Statthalters für Judäa. So wie Esra den Wiederaufbau des gottesdienstlichen Lebens und der rechtlichen Ordnungen betrieben hat, so kümmerte sich Nehemia um den äußeren Wiederaufbau Jerusalem vor allem um den der Stadtmauer.
Kyros wird im zweiten Jesaja als Messias bezeichnet. Wörtlich heißt es in 45,1: „So spricht der Herr zu seinem Gesalbten (=hebr. messchiach; griech. christos), zu Kyrus, den ich bei meiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker von ihm unterwerfe und Königen das Schwert gürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen werden.“ Keine Scheu bei den Juden, einen weltlichen Herrscher als Gesalbten zu sehen. Wie ist dann Jesus als Messias zu verstehen?
Die heute Losung („Die Hand unseres Gottes war über uns, und er errettete uns.“ 8,31) bezieht sich auf den Tag der Rückkehr nach Jerusalem. Das war nichts Feierliches, denn die Rückkehrer wurden feindselig begrüßt. Doch Gott schützte sie.
„Samuel, der Königsmacher“ Episode 47a auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Reiner und das Nicänum – ein altes Bekenntnis verständlich erklärt“ auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
2.2.25
Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias (2.2.25) steht im 2. Buch Mose im 3. Kapitel
Predigt dazu auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land! Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.
Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.“
Die Auslegung ist unter „Predigten“ auf dieser Homepage eingestellt.
- Cato Bontjes van Beek – Widerstandskämpferin auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
- Adelaid Hautval – Widerstandskämpferin auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
- Reiner und das Nizänum – ein altes Bekenntnis verständlich erklärt auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
1.2.25
Das Danielbuch hat zwei Teile (Kapitel 1-6 und 7-12). Im ersten Teil wird erzählt, wie Daniel und seine drei Freunde in der babylonischen Verbannung (6./5. Jh.v.Chr.) ihrem Gott trotz aller Versuchungen und Drohungen die Treue halten, anfangs am babylonischen, später am medisch-persischen Königshof. Der zweite Teil enthält Visionen Daniels, die sich auf eine damals noch sehr ferne Zukunft beziehen. In den Visionen geht es um vier Weltreiche. Auffallend ist die detaillierte Schilderung des vierten Reiches, sodass man an bekannte Probleme denken kann, die im 2. Jh.v.Chr. auftauchten. Das zeigt sich besonders an dem einen Ereignis, das wiederholt erwähnt wird: die Unterdrückung des jüdischen Glaubens und die Entweihung des Tempels in Jerusalem. Beides geschah 168-165 v.Chr. unter dem Seleukidenkönig Antiochus IV Epiphanes und war Anlass für den Aufstand der Makkabäer. Der in den Visionen geschaute Geschichtsverlauf endet mit dem Ausblick auf das baldige Ende des Verfolgers und dem Anbrechen der Gottesherrschaft. Dadurch soll das Volk Israel zum Durchhalten ermutigt werden. Beide Ereignisse gehören zusammen: das Strafgericht Gottes über den Tyrannen und das Endgericht über das Böse insgesamt. Für den Blick der Seher in die Zukunft rückt das zeitlich weit Auseinanderliegende dicht zusammen. Im Licht der Offenbarung des Johannes hat die Alte Kirche die Visionen Daniels gedeutet und das vierte Weltreich statt auf die Herrschaft Alexanders des Großen und die Reiche seiner Nachfolger auf das Römische Reich und seine Erben bezogen. Der Seher spricht von einer himmlischen Gestalt, die aussieht „wie eines Menschen Sohn“ (K. 7). Das hat dazu geführt, dass man im Judentum neben einem politischen Messias auch an einen vom Himmel kommenden Gottesgesandten glaubte, der ein ewiges Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichtet. Diesen haben die Christen in Jesus Christus erkannt. Daniel gehört nicht zu den Propheten, sondern zu den „Schriften“. Es ist apokalyptische Literatur. Sein Thema ist das Kommen der Herrschaft Gottes. Es darf aber nicht missbraucht werden zu spekulativen Berechnungen über das Ende der Welt und der Zeit. Die heutige Losung: „Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande.“ (12,2) bezieht sich auf die Situation der Unterdrückung. Die Treugebliebenen, die ihr Leben für den Glauben eingesetzt haben, werden aufwachen zu einem „ewigen Leben“. Die Verräter und Kollaborateure der heidnischen Macht werden zu ewiger Schmach und Schande aufwachen. Daraus kann man aber nicht ein System von genereller ewiger Erwählung und Verwerfung in Himmel und Hölle machen. In der gesamten Bibel haben wir hier das früheste Zeugnis für die Hoffnung auf eine endzeitliche Totenauferweckung und die einzige Stelle im Alten Testament, wo von „ewigem Leben“ gesprochen wird.
Ich staune darüber, was Menschen zu „sehen“ bekommen, wenn sie unterdrückt werden!
- „Mensch Merz!“ – ein Zwischenruf auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
- „Cato Bontjes van Beek – Widerstandskämpferin“ auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
- „Die Weihnachtszeit geht zu Ende“ – Abschied nehmen mit den Episoden 16b+16c auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
- „Reiner und das Nizänum“ – ein altes Bekenntnis verständlich erklärt auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
31.1.25
Der Psalm 51 trägt den Namen des „Vaters der Dichter“. So sagt es Nelly Sachs und meint den König David. Am Anfang des Psalms wird die Situation genannt: Nathan kommt zu David, um ihn mit seiner Sünde zu konfrontieren, nachdem er mit Bathseba geschlafen hat. Es stimmt nicht, dass es dabei um eine sexuelle Verirrung Davids gegangen sei. Das ist nicht Inhalt der Konfrontation durch Nathan. David hat nie monogam gelebt. Er hatte immer mehrere Frauen. Jahwe selbst hat sie ihm an den „Busen“ gelegt“ (2. Samuel 12,8). Es ging bei dem, was David mit Bathseba machte, um die Missachtung des patriarchalen Eigentumsrechts. Er hat die Frau eines anderen genommen. Dieses Recht des Mannes war Gottesrecht und durfte von keinem anderen gebrochen werden (6. Gebot / 2. Mose 20,14). Zeigt sich hier wieder einmal die königskritische Linie im Alten Testament, die die Könige daran erinnern will, dass sie sich nicht über das geltende Gottesrecht hinwegsetzen dürfen? Der Psalm 51 ist einer der bekanntesten Psalmen. In der Reformation spielte er eine bedeutsame Rolle. Luther griff in seiner Rechtfertigungslehre immer wieder auf ihn zurück. Nicht weniger wichtig war er für Calvin. Der Beter, also David, bittet um Vergebung und Reinwaschung von seiner Schuld. Ihm ist bewusst, dass er an Gott selbst schuldig geworden ist, weil er gegen sein Gesetz verstoßen hat. Und deshalb kann auch nur Gott die Schuld tilgen. „Den Beter treibt seine Sündhaftigkeit um, und es macht auch den heutigen Leser noch betroffen, zu welch radikaler Einsicht in die eigenen Abgründe er dabei geführt wird.“ (Herbert Haag) Gott aber – und nur er allein! – bringt Licht in diese Abgründe, die von keinem „Senkblei der Analyse“ ausgelotet werden können. Die Bitte in Vers 12 („Schaffe in mir Gott ein reines Herz!“) lässt tief blicken. Denn das Wort für „schaffen“ (hebr. bara) ist dasselbe wie bei Gottes Erschaffung von Himmel und Erde. Es ist ein Wort, das ausschließlich für Gottes Tun verwendet wird, niemals für das Tun eines Menschen. Das heißt, der Beter bittet Gott um einen wirklichen Neuanfang, den nur er „schaffen“ kann wie er vorzeiten Himmel und Erde erschaffen hat. Schonungslos öffnet sich der Beter seinem Gott. Er kann vor ihm ja nichts verbergen. Die erkennbare innere Zerbrochenheit ist für Gott kein Grund zur Freude, wohl aber für sein „großes Erbarmen“ (V 3). Gott will diese Zerbrochenheit nicht, deshalb heißt es von ihm, dass er die Zerbrochenen aufrichtet. Was kann ein solcher Mensch vor Gott bringen? Ein Opfer? Das hebräische Wort für <opfern> bedeutet wörtlich <nahekommen>, <sich nähern>. Unser Leben ist es, das wir Gott nahebringen („opfern“) können. So sieht sich der Beter dann vor Gott: „Mein Opfer, Gott, ist ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes, zerbrochenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen.“ (V 19). Dass Gott dieses „Opfer“ annimmt, ermutigt den Beter, Gott zu bitten: „Öffne meine Lippen, dass mein Mund deinen Ruhm verkünde!“ (V 17; heutige Losung)
„Amnon und Tamara – eine Vergewaltigung“ am 31.1. auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Sodom und Gomorra – sexuelle Gewalt gegen Fremde“ am 1.2. auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Reiner und das Nicänum“ am 1.2. auf https://menschen-bei-ewald.letscast.fm
30.1.25
Ein kaum beachtetes Prophetenbuch schreibt Glaubensgeschichte. Denn der Satz, der für Martin Luther die reformatorische Erkenntnis brachte, stammt nicht von Paulus. Der Satz hieß: „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ (Römer 1,17) Noch zwei Mal wird dieser Glaubenssatz im Neuen Testament in zentralen Briefen zitiert. Im Brief des Paulus an die Gemeinden in Galatien (3,11) und im Hebräerbrief (10,38). Der Gerechte wird aus Glauben leben – diese fast sture Glaubensgewissheit stammt vom Propheten Habakuk. Man findet sie in Kapitel 2 Vers 4b. Also muss Paulus diesen Propheten nicht nur gekannt, sondern auch studiert und geschätzt haben. Solche Worte kann man nicht überlesen. Es ist anzunehmen, dass Paulus diese Worte enorm beeindruckt und geprägt haben. Sie geben gerade im Römerbrief den Ton an. Von Habakuk weiß man nichts. In seinem Buch ist nichts von ihm erzählt. Es gibt auch keine Berufungserzählung wie bei anderen Propheten wie Jesaja und Jeremia. Er ist einfach da. Und wer einen ersten Blick in diese drei Kapitel wirft wird bald feststellen, dass der Prophet auch kein Wort an das Volk Israel richtet. Stattdessen richtet sich sein Zorn gegen die Babylonier. Sie sind es, die Habakuk als Existenzgefahr für Judäa und Jerusalem heranziehen sieht. 612 v.Chr. wurde Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Großreichs, von den Babyloniern zerstört. Die Ägypter meinten, das Machtvakuum ausnutzen zu können, wurden aber von Nebukadnezar in der Schlacht bei Karkemisch 605 v.Chr. besiegt. Zwischen diesem Datum und ersten Deportation von Juden nach Babylon 597 v.Chr. (2. Könige 24,10-16) ist das Buch Habakuk entstanden. Die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier 587 v.Chr., die sich anschließende große Deportation nach Babylon und das sich anschließende Exil hat Habakuk nicht mehr erlebt. Noch etwas unterscheidet Habakuk von den anderen Propheten. Er bekommt von Gott keinen Verkündigungsauftrag. Wenn im Hiobbuch gefragt wird: „Wie kann Gott das zulassen?“, so fragt Habakuk seinen Gott angesichts himmelschreienden Unrechts: „Wann tust du endlich was?“ So beginnt sein Buch mit Fragen: „Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen: Frevel!, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu?“ Die Worte der heutigen Tageslosung „Der Herr ist meine Kraft.“ (3,19) stammen aus dem Psalm, der das gesamte dritte Kapitel des Buches ausfüllt.
Wenn Habakuk als Prophet gilt, dann ist es ernst zu nehmen, wenn Menschen Fragen haben oder ungeduldig sind, weil sie sich in dem Wirrwarr der Welt nicht mehr zurechtfinden. Und ihre Frage an Gott „Wann tust du endlich was?“ ist dann mehr als berechtigt.
„Sexualisierte Gewalt in der Bibel“ am 30.1. auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Amnon und Tamara – eine Vergewaltigung“ am 31.1. auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Die wahre Sünde von Sodom und Gomorra“ am 1.2. auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
29.1.25
Saul und David – das ist eine Rivalität, die auf einen Winkelzug des Propheten Samuel zurückgeht. Er hat nämlich Saul zum ersten König von Israel gesalbt. Als dieser gegen eine Weisung Jahwes verstieß, fiel er in Ungnade und blieb darin. Samuel sah das und suchte heimlich nach einem Nachfolger für Saul. Er kam zu Isai und ließ sich von ihm seine Söhne zeigen. Der jüngste war David. Den wählte er aus und salbte ihn heimlich zum König. Samuel also war es, der mit diesem Winkelzug die Rivalität von Saul und David begründete. Liest man die Texte dazu aus dem 1. Samuelbuch, so hat man ständig den Eindruck, dass die Rollen unfair verteilt sind. Saul kommt als Schwächling rüber. Er ist unsicher und weiß nicht recht, was er will. David dagegen wirkt vital, überlegt und clever. Das ist auch die Geschichte um die heutige Losung herum: „Mein Leben werde wert geachtet in den Augen des Herrn, und er errettete mich aus aller Not!, sagte David.“ (1. Samuel 26,24) Was war passiert? Saul wurde darüber informiert, dass David, sein Rivale, nicht weit weg von ihm sein Lager aufgeschlagen hat. Saul machte sich sofort dorthin auf den Weg. Er hatte 3000 Mann dabei. Er schlug sein Lager in der Nähe von David auf. Dieser, wendig und schlau, merkte das und schickte ein paar Leute los, die bestätigten, dass Saul in der Nähe war. Als es langsam dämmerte, machte sich David mit seinen Generälen Ahimelech und Abischai zum Lager Sauls auf. Als sie dort in der Nacht ankamen sahen sie, dass alle schliefen: Saul und sein General Abner ebenso. Saul lag inmitten des Lagerrings. Sein Speer steckte neben seinem Kopf in der Erde, also stets griffbereit. Abischai schlug David vor, Saul den Todesstoß zu versetzen. David lehnte ab, aber nicht aus Mitleid, sondern aus Kalkül. Er hatte Besseres und Klügeres vor. Und er hatte Respekt vor dem Nimbus des Saul als König. So schlich er sich zu Saul und nahm seinen Spieß und seinen Wasserkrug mit. Das war riskant, ja lebensgefährlich. Aber wem sonst als David sollte das gelingen? Als es Tag wurde, nahm sich David Abner, die rechte Hand Sauls, zur Brust und packte ihn an seiner Ehre. Er habe versagt, denn er schlief, als er seinen König hätte bewachen müssen. Denn er war in Lebensgefahr. Abner verstummte und Saul erkannte David an seiner Stimme. David zeigte ihm die Eroberungsstücke: Spieß und Krug. Im Laufe der Unterredung gibt Saul zu, dass er David zu Unrecht nach dem Leben trachtet. Und dann hob David den Wert seines Lebens hervor. Er hat das Leben des Saul verschont. Doch interessanterweise knüpft er daran nicht die Bedingung, dass Saul ihn in Zukunft in Ruhe lassen soll. Er macht es anders. Er hat das Leben des Saul verschont und deshalb wird Gott sein Leben erhalten. Er braucht Saul gar nicht. Daraufhin macht es bei Saul klick. Er weiß jetzt, dass David nicht nur gesalbt, sondern auch gesegnet ist und dass er zurecht bald der König von Israel sein wird.
Zwei Motive zur Jesusgeschichte fallen mir auf: der übereifrige Abischai erinnert an Petrus und im Garten Gethsemane verschlafen die Jünger den Ernst der Stunde.
„Abt Odilo und Hilde Domin“ morgen auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Unbekannte Frauen des Widerstands im 3. Reich“ ab 30.1.25 auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
28.1.25
Weit wichtiger als der „Kopf“ ist dem Alten Testament das „Angesicht“ des Menschen. Es wird im Alten Testament immer pluralistisch als panim verwendet und damit wird an die vielfältige Zuwendung des Menschen zu seinem Gegenüber erinnert. Vorgänge spiegeln sich in den Gesichtszügen (1. Mose 4,5). Der Partner kann schon mit dem Mienenspiel angesprochen werden (1. Mose 31,2.5). Im „Angesicht“ (hebräisch Plural panim) sind die Kommunikationsorgane des Menschen versammelt, unter denen Augen, Mund und Ohren die wichtigsten sind. Was bedeutet das für die heutige Losung: „Herr, behüte mich wie einen Augapfel im Auge.“ (Psalm 17,8)? Davor hat der Psalmbeter Gott darum gebeten, ihn zu hören. Es geht also auch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott um die elementaren Sinne: Mund=sprechen, Ohr=hören, Auge=sehen. Beim Auge ist nicht der reine Sehakt gemeint. Beim Auge – wie bei allen anderen Sinnen auch – geht es um das Aufnehmen und Bewahren von Kommunikation. Ohne Auge, ohne Stimme, ohne Hören geht der Mensch zugrunde. Er lebt davon, dass er die Welt um sich herum durch seine Sinne wahrnehmen kann. So gesehen macht das erst ein sinn-volles Leben aus. Der Mensch ist nicht für sich geschaffen. Er ist auf ein Gegenüber hin geschaffen. Und für ein gemeinsames Leben braucht es die Sinne. Die Bitte des Psalmbeters zielt aber noch tiefer. Er spricht von sich. Er ist der Augapfel. Physionisch betrachtet: der Augapfel liegt in der Augenhöhle und ermöglicht die visuelle Wahrnehmung. Er ist durch eine bindegewebsartige Kapsel und eine Fetthülle geschützt. Zugleich wirken diese Bestandteile gemeinsam wie Kopf und Pfanne in einem Gelenk, sodass der Augapfel reibungslos bewegbar ist. Der Augapfel wirkt lichtbrechend. Wer sich als Augapfel versteht, weiß um seine Bedeutung für den gesamten Körper. Dass Gott ihn unter seine Fittiche nehmen soll heißt nichts anderes, als dass der Schöpfer am besten weiß, dass der Beter ohne Augapfel verloren ist. Er braucht alle Sinne, um in feindseliger Umgebung bestehen zu können. Davon erzählt der Psalm 17 einiges. Am Ende mündet das Gebet wie bei Psalm 23 in einen selbstvergewissernden Satz: „Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit.“ (V15)
„Ewald und Abt Odilo Lechner – Segen, der ins Leben führt“ heute auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
27.1.25
Ich schlage das Losungsbüchlein auf und fange an zu lesen. Ich bleibe an Worten hängen, die für Sonntag, den 26.1.25 galten. Ich komme einfach nicht an ihnen vorbei. Sie haben mich schon erreicht, bevor ich zum Montag rüberschauen kann. Er möge es mir nachsehen. Ich kann nicht anders. Denn auf einen Schlag sind da Bilder, Eindrücke, Gefühle, Gedanken, die dieser eine Satz auslöst: „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen.“ (Jesaja 42,3) Was dieser Satz in mir ausgelöst bzw. freigesetzt hat nenne ich Resonanztanz (ich beschreibe dieses Phänomen nächste Woche in mehreren Episoden auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm) Dieser Satz stammt aus dem ersten von insgesamt vier Liedern des sog. Gottesknechts. Sie wurden in den zweiten Jesaja aufgenommen. Er umfasst die Kapitel 40-55. Diese Lieder singen von einem Mann, der als Knecht bezeichnet wird. „Knecht“ ist im Judentum ein Würdetitel. Nur wenige werden so genannt. Was zeichnet den Knecht aus? Dass er barmherzig ist. Dass er trägt. Dass er eintritt. Dass er einem anderen nicht den letzten Rest gibt. Das bezeugen die Worte von ihm. Zugleich sagen sie zwischen den Zeilen durch die Negativformulierung (zwei „nicht“), was landauf landab gemacht wird. Ist jemand schon geknickt, bekommt er, weil er schwach ist, noch eins oben drauf. Ist das Lebensfeuer eines Menschen noch am Glimmen, dann kommt oft einer daher und tritt auch noch die Glut aus. Das macht der Knecht Gottes nicht. Er sieht und spürt auch noch das letzte Stück Leben auf und schützt das Gebrochene und das Verglimmende. Hält es am Leben. Es waren gerade diese Lieder vom barmherzigen Knecht Gottes, die geholfen haben, das Wesen Jesu zu verstehen. Unvergessen sind die Worte des 4. Liedes, die Eingang gefunden haben in die Karfreitagsliturgie: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. (Jesaja 53,4.5) Ursprünglich meinen sie einen unbekannten Knecht Gottes. Die ersten Jesusgläubigen, die ausschließlich die jüdische Bibel hatten, haben darin ihren „Jesus“ entdeckt. Spricht: sie haben ihre Bibel, die jüdische, von Jesus her gelesen.
„Ewald und frère Roger – Taizé wär´s gewesen“ heute auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
26.1.25
Der Predigttext für den 3. Sonntag nach Epiphanias kommt aus dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums:
Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief; woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.
Meine Auslegung steht unter „Predigten“ auf dieser Homepage.
„Ewald und Jürgen – eine zerbrochene Freundschaft“ heute auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
25.1.25
Dorthin soll Jona gehen – nach Ninive in das Machtzentrum der imperialen Großmacht der Assyrer. Sie haben das Nordreich Israel 732 v.Chr. erobert und dem Erdboden gleich gemacht und später haben sie auch im Südreich gewütet und nur durch einen Vasallenvertrag wurde Jerusalem verschont. Die Assyrer waren bekannt für ihre Brutalität. Auf Palastreliefs sind die zahlreichen Techniken ihrer Tötungsarten und der grausame Umgang mit Gefangenen abgebildet. Die Armee der Assyrer glich einer Walze, die alles überrollt, was sich einem in den Weg stellt. Die Assyrer galten als die Macht des Nordens. Israel hat durch sie ein Trauma erlebt. Und in deren Machtzentrum soll Jona jetzt gehen und dort einer vor Kraft und Selbstbewusstsein strotzenden Großmacht das Gericht Gottes verkünden bzw. deren Untergang. Das heißt: Jona muss als traumatisiertes Mitglied des Volkes Israel dem Traumaverursacher begegnen. Das ist eine Zumutung. Das kann er eigentlich nicht überleben. Wenn er überhaupt gehört wird. So ist verständlich, dass sich Jona das nicht zutraut. Er flieht, weil ihn schon rein gedanklich die Begegnung überfordert. Im Fisch findet er zu sich. Nach drei Tagen und Nächten wird er an Land gespuckt und geht dann doch nach Ninive. Er kündigt ohne Verve, ohne Emotion, also anders wie sonst die Propheten, das Gericht Gottes an. Mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft stellt er sich dem Traumaverursacher. Er kann aber nur „Dienst nach Vorschrift“ machen. Er überlebt die Konfrontation und ist anschließend so erschöpft, dass er sterben will. In der Traumaforschung wird das Erschöpfungsdepression genannt. Er kann die Reizüberflutung nicht verarbeiten. Das heißt, Jona war mit dieser Aufgabe überfordert. Sie hat seine psychische Kraft aufgezehrt. Das Trauma ist noch nicht verarbeitet. Und dann muss er wahrnehmen, dass es sich Gott anders überlegt hat und Ninive, also die traumatisierende Großmacht, verschont. Dahinter steht der Gedanke, dass der Gott Israels der Gott aller Völker ist und demnach seine Gnade allen Völkern gilt. Das ist dann zu viel für Jona. Daher endet das Jonabuch mit einer Frage Gottes an Jona: Mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? (4,12)
Die Frage bleibt bis heute. Sie stellt sich auch uns. Das Jonabuch lädt ein zum ernsthaften Nachdenken über verschonte Täter bzw. Traumaverursacher und überforderte Opfer bzw. Traumatisierte und deren extrem belastetes Verhältnis zueinander. Wird die Antwort auf die Frage Gottes an Jona jemals Tätern und Opfern gerecht werden können?
„Ewald und Hiob – den inneren Freund finden“ heute auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
24.1.25
Die heutige Losung aus dem Jonabuch legt es nahe, das Buch Jona anzusehen. Es hat vier Kapitel, aber die haben es in sich. Als einziges Buch der Bibel endet es mit einer Frage, die heute noch beantwortet werden will. Es gibt einen neuen Zugang zu diesem Buch und dem Verständnis des Propheten Jona als Traumaliteratur. Aus dieser Sicht heraus eröffnen sich neue Erkenntnisse, die im Jonabuch zu finden sind. Mich hat das überzeugt und ich möchte diese Auslegung deshalb hier vorstellen. Das ergibt dann einen längeren Text. Daher heute der erste Teil und morgen der zweite Teil.
„Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.“ (Losung heute aus Jona 2,9). Das betet der Prophet Jona. Der Ort ist spektakulär. Jona betet im Bauch eines großen Fisches, der ihn verschlungen hat. Dort war er drei Tage und drei Nächte. Also! Frage: Wie ist das Jonabuch zu verstehen? Auf Kinderbibeltagen war es und ist es der Renner. Gerade aus Sicht von Kindern ist im Jonabuch alles groß. Nicht nur der Fisch, auch das Böse, die Angst, die Stadt Ninive. Am imposantesten ist natürlich der Fisch und dieses große Geheimnis, wie das kommen kann, dass Jona von einem Fisch verschlungen wird und im Bauch des Fisches überleben und sogar noch beten kann und nach drei Tagen und Nächten an Land gespien wird. Ist das Jonabuch also ein Stoff für Kinder? Wenn man es so sehen will, dann ist es das. Aber in Zeiten davor war es anders. Das Jonabuch war von den Anfängen des Christentums bis in die Renaissance ein hoch angesehenes Buch. Schon die Katakomben der ersten Christen waren mit Motiven des Jona verziert. Das Jonabuch war ein beliebtes Motiv in der Malerei und in der Kunst. Das lag daran, weil man mit Jona das Christusgeschehen verstehen konnte. Dabei verstand man die Dunkelheit im Bauch des Fisches als Ort des Todes und die Ausspeiung Jonas durch den Fisch ins Helle als Hinweis auf die Auferstehung Jesu von den Toten (siehe auch Matthäus 12,39 und Lukas 11,29) nach drei Tagen. Neuere Forschungen helfen, das Jonabuch als Traumaliteratur zu verstehen. Wie das? Bisher wurde Jona als Prophet angesehen, der sich weigert, den Auftrag Gottes auszuführen und Ninive den Untergang anzukündigen. Doch Jona macht das Gegenteil. Er flüchtet sich auf ein Schiff und muss erkennen, dass der Sturm, der die Menschen bedroht, auf seine Kappe geht. Schließlich muss er über Bord und wird von einem Fisch verschlungen – und überlebt in ihm! Die Einschiffung muss als Flucht verstanden werden, die typisch ist für traumatisierte Menschen. So flieht Jona in die entgegengesetzte Richtung. Nicht nach Ninive, sondern nach Tarsis am äußersten Ende des Mittelmeers. Bisher deutete man das als Ungehorsam des Jona. Doch aus Sicht der Traumaliteratur ist das ein Fluchtreflex, gegen den er nichts machen konnte und wie er bei traumatisierten Menschen passiert. Sie haben keine Kontrolle über ihren Flucht- oder Totstellreflex (Jonas Reaktion auf dem Schiff ist so verstehen und nicht als Gleichgültigkeit gegenüber den anderen), wenn eine Begegnung mit dem Traumaverursacher ansteht oder sie, therapeutisch begleitet, in die traumatische Situation rückgeführt werden. Jona gerät schlichtweg in Panik bei dem Gedanken, ins Zentrum der Macht zu gehen, die seinem Volk und damit auch ihm Schlimmes zugefügt hat. Und das ist Ninive, das Machtzentrum des assyrischen Imperiums.
Ab morgen eine autobiographische Reihe auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Ewald und Hiob“ – „Ewald und Jürgen“ – „Ewald und frère Roger“ – „Ewald und Abt Odilo“ – „Abt Odilo und Hilde Domin“
23.1.25
Wie ist das mit der Wahrheit? Jesus scheute sich nicht, sie zu sagen. Das war nicht immer bequem für ihn und Applaus bekam er selten dafür. Schon gar nicht von seinen Gegnern. Und das waren in der Regel die Pharisäer. Wie auch in dem Fall, der dem heutigen Lehrtext vorangeht. Jesus sagte da etwas über einen Finanzier, also einen, der das Geld anderer Leute verwaltet und vermehrt. Einer der Art, dem Geld anvertraut wird und der das gewinnbringend anlegt. Das Einzige, was man so einem Finanzmenschen entgegenbringt außer seinem Geld ist Vertrauen. Es gibt in der Branche leider schwarze Schafe, die das Vertrauen missbrauchen und zocken statt anzulegen und treu zu verwalten. Das jedenfalls spricht Jesus an und sagt die Wahrheit – jetzt ganz allgemein: ein Mensch kann sich nicht aufteilen in einen treuen Teil und einen untreuen. Wenn treu, dann treu. Wenn untreu, dann untreu (Lukas 16,10). Und er sieht es, dass Geld auch unredlich erworben wird und dass ehrliche Leute solchen Gaunern ihr erarbeitetes Geld niemals anvertrauen würden. Damit hat Jesus den Nerv der zuhörenden Pharisäer getroffen. Man weiß ja: Geprellte Hunde bellen. Diese Wahrheit ließen die Pharisäer nicht auf sich sitzen. Lukas nennt sie „geldgierig“ (Lukas geht es grundsätzlich um das Verhältnis zu Geld und Besitz). Gier soll die Wurzel alles Bösen sein, heißt es. Das gilt so lange als Wahrheit, bis das Gegenteil bewiesen wird. Gierig nach Geld sein heißt, dass jede Moral und jede Ethik ausgeschaltet sind. Das kann man sich bei Pharisäern jetzt nicht richtig vorstellen, denn wenn es richtige Pharisäer sind, dann müsste ihnen Geldgier oder unrecht erworbenes Geld so fern sein wie der Mond von der Erde – also unerreichbar. Offenbar stand da aber eine Gruppe von „gefallenen“ Pharisäern zusammen, grinsten, lachten sich eins über diesen Wahrheitsprediger und spotteten über ihn. Das muss Jesus gehört haben. Interessant ist, dass nicht wie sonst die Pharisäer in ein Streitgespräch mit Jesus eintreten. Wie sollten sie auch! Jesus hatte ihre Gier ja aufgedeckt. Da gibt´s nichts mehr zu diskutieren. Aber spotten geht immer! Das wiederum akzeptiert Jesus nicht und spricht sie direkt an. Sinngemäß sagt er: „Ihr seid gerissen, das wisst ihr. Ihr meint, Geld stinke nicht. Ihr legt euch das schön zurecht und sagt zu den Leuten, dass euer Handeln vollkommen in Ordnung sei. Die Menschen mögen Euch das abkaufen. Aber da ist einer, der sieht hinter die Fassade und der weiß, was ihr für Gauner seid. Er verabscheut euer Tun. Und verwechselt nicht die Position: hoch angesehen bei Menschen ist das eine. Aber kommt damit nicht zu Gott. Der wendet sich von euch ab, wenn ihr ihm so kommt.“ (heutiger Lehrtext aus Lukas 16,15)
Das scheint mir eine passende Antwort auf den eigenartigen Kosmos von Donald Trump zu sein.
Dazu auch „Ewald und Trump“ auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Noomi und Rut – eine bewegende Frauenliebe“ am 23.1.25 auf meinem Podcast https://informiert-glauben.letscast.fm
Am 25.1. beginnt eine autobiographische Reihe auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm mit folgenden Episoden:
25.1. „Ewald und Hiob“ / 27.1. „Ewald und Jürgen“ / 29.1. „Ewald und frère Roger“ / 31.1. „Ewald und Abt Odilo“ / 2.2. „Abt Odilo und Hilde Domin“
22.1.25
„Das Gesetz und die Propheten“ ist ein geläufiger Begriff auch zur Zeit Jesu. Das Gesetz (hebräisch meint es die „Thora“=5 Bücher Mose) war für die Sadduzäer die oberste Kategorie. Von den Propheten hielten sie nicht so viel. Anders war das bei den Pharisäern. Für sie war die Thora ethisch gesehen unersetzlich, aber sie kannten auch die Botschaft der Propheten an. Neben den großen Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel gab es andere sog. „kleinere“, die aber nicht weniger bedeutsam waren. Man denke an Amos oder Hosea, Obadja oder Nahum. Die heutige Losung kommt aus dem Propheten Jesaja: „Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen.“ (6,5) Dieses Erschrecken geschieht, während Jesaja von Gott zum Propheten berufen wird. Jesaja lebte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Er war Prophet am Jerusalemer Tempel. Dort erlebt er seine Berufung. Draußen zieht eine große Gefahr herauf. Die Assyrer sind dabei, Israel zu erobern. Da kommen Fragen auf: Was bedeutet das jetzt konkret? Was will Gott seinem Volk damit sagen, wenn Gott mit den Assyrern an die Tür klopft? Würde Gott retten oder ist das Kommen der Assyrer eine Strafe Gottes? Steckt in politischen Ereignissen ein tieferer Sinn? Erst nach dieser und zwei weiteren Katastrophen bzw. Traumata kam die Zeit des Verarbeitens im Exil. Und dort wurde eine Antwort auf das Zurückliegende gefunden. Diese Antwort spiegelt sich im Aufbau des Buches Jesaja wider: in den Kapiteln 1-39 wird die Zerstörung Israels als Gericht Gottes über das „unreine“ Volk berichtet. In den Kapiteln 40-55 (jetzt kamen auch die judäischen Traumata von 599 und 587 v.Chr. dazu) wird das Geschehene reflektiert und Buße getan und Gottes Barmherzigkeit und Freundlichkeit erlebt. In den Kapiteln 56-66 geht es um Aufbruch und Neubeginn. Die Kapitel 40-55 werden auch Trostbuch Israels genannt.
Wehe mir, ich vergehe! ruft Jesaja aus zurecht. Denn er ist von der Gegenwart Gottes umgeben. Diese erschütternde Gotteserfahrung brachte Jesaja auch den Titel „Prophet des Heiligen“ ein. Gert Otto hat zwei Dinge unterschieden, die geschehen, wenn jemand von der Heiligkeit Gottes ergriffen wird: das mysterium tremendum und das mysterium fascinosum. Jesaja hat ersteres erlebt. Er erschaudert, er erschrickt. Das ist viel mehr als eine Gänsehaut kriegen. Dieses Erschüttern geht unter die Haut, weil es die Unreinheit freilegt: seine eigene und die des Volkes, in dem er lebt. Diese Gotteserfahrung ermächtigt Jesaja, seinem Auftrag als Prophet gerecht zu werden.
Für uns Heutige könnte das heißen, für beide Seiten Gottes empfänglich zu sein. Gott ist kein spirituelles Wellnessangebot. Die Begegnung mit ihm kann erschüttern und so zu tiefgreifender Selbsterkenntnis führen.
„Ewald und Trump“ aus aktuellem Anlass auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Ewald und…“ eine autobiographische Reihe ab dem 25.1.25 auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„Noomi und Rut – eine bewegende Frauenliebe“ 24.1.25 auf meinem Podcast https://informiert-glauben.letscast.fm
21.1.25
Am Sonntag, den 19.1.25 (2. Sonntag nach Epiphanias) hat unsere Pfarrerin Anna-Maria Semper in einer nahezu voll besetzten Bahlinger Bergkirche einen Textabschnitt aus dem Römerbrief gepredigt (siehe unter 19.1.25 auf dieser Homepage). Die Resonanz auf ihre Predigt war in der Zuhörerschaft, unter der auch viele waren, die um Leon Schaur trauerten, spürbar. Ihre Predigt wird hier wiedergegeben.
—————————————————————————————————————————————-
»Bring den Müll raus!«, »Räum dein Zimmer auf!« »Mach endlich die Steuererklärung!« Mach dies. Mach das. Lass das bleiben. Aufforderungen, Anweisungen, Ermahnungen. Da sind so viele Dinge, die ich tun soll. Am besten: sofort. Dinge, die andere mir verordnen. Oder ich mir selbst. Da hilft nur eins: eine To-Do-Liste. Ungeliebt. Aber ungemein nützlich, um nicht im Aufgaben-Chaos zu versinken. To-Do-Listen. Ungemein nützlich, ja. Aber sonntags, da will ich sie beiseitelegen. Durchatmen. Neue Kraft schöpfen.
Ich höre, was der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt – abgedruckt in unseren Bibeln bis heute, als Wort an uns. Wir haben es gerade in der Lesung gehört.
Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit.
Verabscheut das Böse. Liebt. Übertrefft euch gegenseitig. Lasst nicht nach. Bleibt standhaft. Helft. Seid gastfreundlich. Segnet. Freut euch mit. Weint mit. 21 sind es insgesamt. 21 Aufforderungen, 21 Anweisungen.
Ich höre, was Paulus schreibt. Und ich höre viele Ausrufezeichen.
Soviel zum To-Do-Listen-freien Sonntag. Innerlich habe ich schon damit begonnen, die nächste zu schreiben. Meine To-Do-Liste für gutes Christsein: „Liebe aufrichtig, ungeheuchelt!“ Steht ganz oben. Das gefällt mir: dass die Liebe ganz oben steht auf der Liste. Andererseits: Aufrichtig lieben… das ist nichts zum Abhaken. Das ist nie „erledigt“. Nicht bei Menschen, die mir nahestehen. Und so wie Paulus es gemeint hat erst recht nicht… als Liebe zu Menschen in der christlichen Gemeinde, unterschiedslos, egal ob arm, ob reich, ob umgänglich oder anstrengend… einfach, weil sie Gottes Kinder sind…
Puh. Da werde ich wohl nie einen Haken setzen.
Vielleicht nehme ich mir zuerst etwas anderes vor, weiter unten auf der Liste. Freut euch mit den Fröhlichen. Ja, das kann ich schaffen, glaube ich. Weint mit den Weinenden. Hm. Das gehört wohl beides zusammen, fürchte ich. Das eine ist nicht echt ohne das andere. Segnet die, die euch verfluchen. Denen, die schlecht über mich reden, Gutes wünschen? Das bringt mich jetzt wirklich an meine Grenzen, Paulus!
Stopp!
Liebe Gemeinde, bevor ich Sie weiterjage durch die To-Do-Liste für gute Christen, die da gerade in meinem Kopf entsteht… sollten wir uns fragen, ob da wirklich eine ist bei Paulus. Eine To-Do-Liste. Ich habe gehört, was Paulus schreibt. Und ich habe Ausrufezeichen gehört. Jede Menge. Sie vielleicht auch. Tu dies, tu das! Wir sind daran gewöhnt. Wir erwarten das. Und je nachdem wie es uns gerade trifft, legen wir los – oder schalten auf Durchzug. Aber was, wenn da gar keine Ausrufezeichen sind?
Paulus schrieb zu einer Zeit, da war das Ausrufezeichen noch gar nicht erfunden. Paulus schrieb, wie in der Antike üblich, ohne Punkt und Komma. Das sparte Platz und Papier. Das erste Ausrufezeichen in einer Bibel ist erst von 1797. 1797. Lassen wir das mal auf uns wirken. Kein Ausrufezeichen bei Paulus. Vielleicht denken Sie jetzt: „unnützes Wissen“. Macht am Ende keinen Unterschied für mein Leben. In diesem Fall aber doch. Schaut man etwas genauer hin in Paulus‘ Text, in der Sprache, in der er ihn ursprünglich geschrieben hat, auf Griechisch… dann sind da nicht nur keine Ausrufezeichen zu entdecken, sondern die ganze Art und Weise, wie er schreibt über das Leben als Christ, die hat ganz wenig Forderung in sich, ganz wenig von „ihr sollt“ und „ihr müsst“. Das ist nur auf Deutsch unheimlich schwer wiederzugeben. Da kommt jede Übersetzung an ihre Grenzen. Wie Paulus den Christen in Rom schreibt… das ist eher eine Vision. Sein Traum davon, wie das aussehen kann, wenn Menschen ganz durchdrungen sind von Gottes Liebe – und das ausstrahlen in ihre Welt. Gottesdienst – im Alltag.
Legen wir die innere To-Do-Liste beiseite. Hören wir noch einmal hinein in Paulus‘ Worte. Ohne Ausrufezeichen. Mit ganz wenig „du musst“. Und ganz viel „Wie wäre es, wenn…?“
Da ist Liebe in der Welt, träumt Paulus. Aufrichtige, ungeheuchelte Liebe. Weil sie aus Gottes Liebe erwächst. Und die ist nie geheuchelt.
Da sind Menschen, die verabscheuen das Böse – und halten am Guten fest.
Da sind Menschen, einander herzlich zugetan – in geschwisterlicher Liebe. Wertschätzend, respektvoll im Umgang miteinander. Weil es einen gibt, der sie seine Schwestern und Brüder genannt hat, schon lange zuvor.
Da sind Menschen, die sind nicht träge in dem, was sie tun. Sie brennen im Geist. Sie dienen Gott. Weil er diesen Funken in ihnen entfacht hat, der nicht mehr ausgeht.
Da sind Menschen, die freuen sich – sie haben Hoffnung. Die sind geduldig und beharrlich – sie haben das Gebet.
Da sind Menschen, die helfen, die nehmen Anteil an dem, was ihren Mitchristen geschieht und sind gastfreundlich – denn sie haben erlebt, dass Gott sie an seinen Tisch einlädt.
Diese Menschen: Die dürft ihr sein.
Ihr dürft segnen, Menschen Gutes wünschen. Ja, sogar denen, die euch übel mitspielen. Nicht, dass das leicht wäre. Aber wie wäre das… wenn das Böse, was das durch sie geschieht, plötzlich keine Macht mehr hätte über euch? Keinen Platz in euren Gedanken, keinen Platz in euren Mündern? Sich freuen mit den Fröhlichen, Weinen mit den Weinenden. Dafür wäre Platz. Nach Einigkeit streben – weil ihr schon eins seid in Christus. Den einen nicht höher achten als den anderen wegen seines Ansehens in der Welt – weil Christus nicht auf euer Ansehen schaut. Nicht von euch selbst allzu viel Kluges und Großes erwarten – aber Gott viel zutrauen.
Wie wäre das? fragt Paulus die Christen in Rom.
„Wie wäre das?“, fragt Paulus uns. „Wie wäre das, wenn ihr da keine 21 Ausrufezeichen hört in meinem Text. Vielmehr: 21 Weisen, wie Gottes Liebe Menschen bewegt – und damit einen Unterschied macht in der Welt. Und wie wäre das, wenn ihr diese Menschen wärt?
Ihr braucht keine To-Do-Liste. Ihr müsst euch nicht irre machen. Das führt in die Verzweiflung. Denn da ist nichts an meiner Vision, was sich abhaken ließe. Wie wollt ihr Liebe abhaken? Aber: Gott gibt euch Anteil an seiner Liebe. Und deshalb kann da etwas draus werden. Aus dem, was ihr tut und lasst und aus dem wie ihr hofft und liebt und glaubt.
Wie wäre das?“
Liebe Gemeinde, Vielleicht fangen wir heute damit an, dass wir uns von Gott beschenken lassen. Dass wir uns einladen lassen an Gottes Tisch. Brot miteinander teilen und Wein und Traubensaft. In den Blick nehmen, wer außer uns noch gekommen ist. Gemeinschaft erfahren und Zuwendung und Stärkung.
Und dann, dann darf daraus etwas wachsen. Amen
„Ewald und Trump“ morgen auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
„David und Jonathan – eine bewegende Männerliebe“ heute auf https://informiert-glauben.letscast.fm
20.1.25
Da war eine große Erleichterung. Da war eine riesige Freude. Da war Aufbruch. Und da war auch das andere. „Ihr könnt gehen. Wir bleiben.“ So oder so ähnlich könnte man die innere Lage der 598 und 587 v.Chr. nach Babylon exilierten Juden beschreiben. Es ist eingetroffen, was der zweite Jesaja den Exilierten angekündigt hatte. Sie werden wieder frei. Sie werden zurückgehen können. Der Perserkönig Kyros hatte die Babylonier besiegt und in einem Edikt verfügt, dass die exilierten Juden nach Juda zurückkehren können. Bei ihnen war der Widerhall aber unterschiedlich. Denn es war schon zu lange her. Das Exil der Judäer dauerte fünfzig und das der im Jahr 598 Exilierten sechzig Jahre. Von denen, die bei der Zerstörung Jerusalems dreißig Jahre alt waren, konnten unter den Rückkehrern nur noch wenige alte Leute sein, von denen im Jahre 598 Deportierten wird bei der Rückkehr kaum einer dabei gewesen sein. Die Kinder der Deportierten waren in einem anderen Land aufgewachsen, sie kannten die Heimat der Eltern nur aus deren Erzählungen. Sie hatten in Babylon wohl oder übel Fuß fassen müssen. Das alles muss man sehen, wenn man Erwartung und Wirklichkeit der Heimkehrer vergleicht. Hinzu kommt, dass das Land, in das die Heimkehrer kommen, nicht leer ist. Die Häuser, wenn nicht zerstört, hatten andere bezogen. Äcker und Weinberge hatten andere in Besitz genommen. Es waren viele Judäer im Land geblieben. Die waren nicht begeistert von der Rückkehr fremder Landsleute. Das Leben war weitergegangen. Juda war auch nicht eigenständig, sondern eine Provinz des persischen Reiches. Wenn Erwartung und Hoffnung sich erfüllen, beginnt die Arbeit an den ersten kleinen Schritten. Da braucht es Wegbegleitung, ein Ausruhen in Worten, die halten. So ein Wort ist die heutige Losung aus dem Propheten Jesaja im 60. Kapitel Vers 19: „Der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein.“ Ja schon. Doch davor stehen folgende Worte: „Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten.“ Was heißt das? Es wird den Menschen der Glaube ihres Volkes neu zugesprochen. Sie dürfen in ihrem Gott wieder den sehen, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat. Trost erfahren sie nicht im Geschöpflichen, sondern im Schöpfer. Man könnte auch sagen: den nachexilischen Propheten drängt es, den Menschen in einer Umbruchsituation zu sagen: „Lasst euch nicht auf das Diesseits vertrösten. Es gibt ein Licht, das heller scheint als die Sonne, die den Tag macht. Es gibt einen Glanz, der heller strahlt als der Mond in der Nacht.“ Der Prophet ist hier unglaublich präsentisch. Wenn er oder ein anderer Mensch das ist, dann ist er mit seinem Herzen ganz bei den Menschen, die ihn brauchen. Er ist dann mit seinem Dasein und seinen Worten ihr Seelsorger. Prophet ist er dann in dem Sinn, dass er die Zukunft in einer Farbe malt, die in der Vergangenheit gestrahlt hat.
Ich meine, das gilt auch heute. Deshalb will ich sagen: „Lass dich nicht aufs Diesseits vertrösten. Schau tiefer, schau weiter, schau höher. Nimm Sonne und Mond und sieh sie als Geschöpfe dessen an, der sie zum Licht gemacht am Tag und in der Nacht. Und dann werde dir bewusst, dass du sein Geschöpf bist und sage dir: Ich bin sein von Ewigkeit her geliebtes Kind!“
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Wenn du tiefer in Themen des Glaubens einsteigen willst, empfehle ich dir meinen Podcast https://informiert-glauben.letscast.fm
19.1.25
Endlich Sonntag! Der Sonntag ist nach christlichem Verständnis der erste Tag der Woche. In der christlichen Tradition beginnt also die Woche mit einem Feiertag. Kern des Sonntags ist die Botschaft von der Auferweckung Jesu von den Toten. Deshalb wird der Sonntag in anderen Ländern auch „Tag des Herrn“ genannt. Die Tage, die dem Sonntag folgen, beziehen sich auf die entscheidenden Tage im Leben Jesu. So ist der Donnerstag der Gründonnerstag („grün“ kommt von „greinen“, was „weinen“ oder „klagen“ bedeutet), der Freitag ist der Karfreitag und der Samstag ist der „stumme Tag“, der Tag des Schweigens, der in den Osterjubel mündet, in den die Gemeinde am Sonntag einstimmt. Heute (2. Sonntag nach Epiphanias) wird in den Gottesdiensten der Evangelischen Kirche ein Textabschnitt aus dem Brief an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel ausgelegt.
Der Apostel Paulus schreibt:
Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug.
Auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm wird dieser Text zu hören sein. Ich gebe dazu eine Anleitung, wie man (nicht nur biblische) Texte hören kann.
Wenn du tiefer in Themen des Glaubens einsteigen willst, empfehle ich dir meinen Podcast https://informiert-glauben.letscast.fm
18.1.25
Der heutige Lehrtext aus dem Philipperbrief führt in eine einmalige historische Situation hinein: in den Übergang des Evangeliums nach Europa. Angelandet in Makedonien, genauer gesagt in Philippi. Um 49/50 n. Chr. gründete der Apostel Paulus mit Silas hier eine christliche Gemeinde (Apostelgeschichte 16,11ff.). Es ist die erste Gemeinde, die er in Europa gründete. Philippi war so was von römisch. Die meisten Bewohner waren ehemalige römische Soldaten, die sich hier mit ihren Familien zur Ruhe setzten. Es gibt keine griechische Inschrift. Die Stadt strotzte nur so vor römischem Selbstbewusstsein. In Philippi gab es keine Synagoge. Als erste Christin wird die Purpurhändlerin Lydia genannt, die aus Thyateira in Kleinasien, heute Türkei, stammte. Sie hatte sich als nicht jüdische „Gottesfürchtige“ bereits vorher zur jüdischen Gemeinde gehalten. Paulus hatte eine jüdische Gebetsstätte am Fluss aufgesucht und zu den Frauen, die sich dort versammelt hatten, gesprochen. Lydia und alle Angehörigen ihres Hauses ließen sich aufgrund der Verkündigung des Apostels Paulus taufen. An die Gemeinde in Philippi schrieb Paulus wahrscheinlich von Rom aus, wo er in Gefangenschaft lebte, um 60 n.Chr. Sie war seine Lieblingsgemeinde. Wie auch beim ersten Thessalonikerbrief, dem ältesten Schriftstück im Neuen Testament, so gilt Paulus hier zwar als Verfasser. Aber der Brief ist wohl auch wie jener in einem gemeinsamen Denk- und Austauschprozess mit seinem Weggefährten und Glaubensbruder Timotheus entstanden. Interessant ist auch, dass es in Philippi schon erste Ämter gab, denn Paulus grüßt nicht nur die Gemeinde, sondern auch deren Bischöfe und Diakone. Da ist in 10 Jahren einiges gewachsen. Im Mittelteil des Briefes teilt Paulus der Gemeinde ein zu Herzen gehendes Geheimnis mit und lässt den Weg des Christus im sog. Christushymnus hell erstrahlen (2,3-11). Er soll sich im Miteinander der Gemeinde widerspiegeln. Fast am Ende angekommen, lässt es sich Paulus nicht nehmen, die Gemeinde zur Freude zu ermuntern (4,4), wobei hier zu bedenken ist, dass im Griechischen Freude und Gnade denselben Wortstamm haben. Freude ist also eine tiefe innere Dankbarkeit für das Erbarmen Gottes. Was die Außenwirkung der Gemeinde betrifft, rät er dazu, allen Menschen zu zeigen, dass man ihnen trauen kann, weil sie glaub-würdig leben. Er befiehlt die Gemeinde letztlich dem Frieden Gottes an, der allen Verstand übersteigt. Diesen Frieden muss man in seiner Breite aus dem Judentum heraus verstehen. Der Schalom meint ein Wohlergehen des ganzen Menschen in allen seinen Lebensbezügen.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Wenn du tiefer in die Themen des Glaubens einsteigen willst, empfehle ich dir meinen Podcast https://informiert-glauben.letscast.fm
17.1.25
„Eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn.“ (Losung Sprüche 5,21) Scheint ja alles klar zu sein. Vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Das kann man so sagen. Aber wehe es verwechselt sich jemand mit Gott und meint, er hätte Anspruch darauf, alles zu erfahren, was das Kind, die Partnerin, der Nachbar oder wer auch immer denkt und was er oder sie vorhat. Ich habe das in meiner Jugend erlebt. Da haben sich selbsternannte Seelsorger, sogenannte Laien, doch tatsächlich erdreistet, mir in einer Beichte erklären zu müssen, wohin mein Weg gehen soll. Das hat mich unglaublich unter Druck gesetzt. Ich wurde über einen längeren Zeitraum meines Lebens nicht froh und das als junger Mann. Das hat mit der heutigen Losung zu tun. Liest man nicht nur diesen einen Vers, sondern das ganze Kapitel 5, aus dem die Losung genommen wurde, fällt einem eine Zweiteilung auf. Im ersten Teil, den Versen 1-11 geht es darum, dass wahrscheinlich eine Mutter ihren Sohn davor warnt, sich auf eine fremde Frau einzulassen. Wörtlich heißt es da: „Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim, und ihre Kehle ist glatter als Öl, hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwerz. Ihre Füße laufen zum Tode hinab; ihre Schritte führen ins Totenreich, dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst; haltlos sind ihre Tritte, und du merkst es nicht.“ (Vv3-6) Kümmert man sich jetzt nicht um den Zusammenhang, in dem diese Rede steht, dann kann das ganz schnell dahin ausgelegt werden, dass man als junger Mann sexuell enthaltsam leben soll. Weibliche Sexualität wird als verführerisch beurteilt und ist der Sex vorüber, bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Also, empfehlen die Laienseelsorger: Lebe asketisch, bis die richtige Frau kommt! Und der junge Mann wird mit seiner Verzweiflung allein überlassen. Liest man aber weiter, wird man eines Besseren belehrt. Es heißt in den Versen 17-20: „Habe du sie allein (die Frau deiner Jugend), und kein Fremder mit dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allezeit sättigen und ergötze dich allewege an ihrer Liebe. Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere?“ Und dann schließt sich die heutige Losung an, die man so verstehen kann: Gott will, dass du, mein lieber Sohn, den richtigen Weg gehst und dich erfreust an der körperlichen Liebe mit der Frau deiner Jugend. Das ist ok. Die jungen Menschen dürfen sich als sexuelle Wesen sehen und es spricht aus diesem Weisheitstext geradezu eine Erlaubnis, die Sexualität zu genießen. Die fremde Frau übrigens ist die verheiratete Frau. Gottgefällig ist es in diesem Kontext, dem Rat der Mutter zu folgen und die körperliche Liebe mit der Frau der Jugend zweckfrei zu genießen und die Finger wegzulassen von Frauen, die verheiratet sind.
Diese Erkenntnis wird einem geschenkt, wenn man die Bibel ganz liest und nicht partiell und aus diesem Partiellen dann ein System macht, das Menschen einengt oder sogar krank macht.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
16.1.25
Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen beschäme; und was schwach ist vor der Welt, das hast Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist, und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist, auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. (1. Korinther 1,27.28) Das ist O-Ton Paulus. Es gibt für diese Worte keine Vorlage. Diese fast hymnisch anmutenden Worte kommen direkt aus dem Herzen des Paulus. Der Zielpunkt dieser Worte ist die Absage an jede Art von Protzerei, um das Rühmen einmal etwas despektierlich zu bezeichnen. Aber natürlich war das Rühmen das Ergebnis eines sittlich annähernd perfekten Lebens. Das war das Lebensziel sowohl in der griechischen als auch jüdischen Kultur. Menschen, die anständig und sittlich gut leben, sind nicht anrüchig. Sie sind Vorbilder für andere. Sie tun, was sittlich geboten ist und vermeiden, was dem anderen schadet. Das ist alles ok. Und doch meint Paulus, gerade dieses Rühmen als Ergebnis eines sittlich einwandfreien Lebens kritisieren zu müssen. Stattdessen zelebriert er die Kehrseite des Rühmens: das Törichte, das Schwache, das Nichtige. Und damit nicht genug. Gott hat die Kehrseite des sittlich perfekten Lebens ausgewählt. In der Wortwahl des Paulus muss man das so sehen, dass er meint, Gott habe sich alles angeschaut und sich dann für das Törichte, Schwache und Nichtige entschieden. Warum? Will Gott nicht, dass die Menschen gut, reflektiert und anständig leben? Wieso die Schattenseite? Paulus entwirft diese Einstellung aus dem Eindruck des Kreuzestodes Jesu heraus. Er sagt in Kapitel 1 Vers 23: „Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit.“ Paulus lässt offenbar bewusst das Wichtigste des Christusglaubens weg: die Auferweckung Jesu. Er entscheidet sich die Schattenseite des Lebens Jesu erstrahlen zu lassen. Diese war in keinster Weise vorzeigbar: Blut, Tränen, Schweiß, Nägel, Schreie, Verrat. Das will keiner hören und keiner ansehen. Damit kann niemand Gott imponieren. Das Kreuz steht diametral zu allem, was man nicht vorweisen kann, womit man eben nicht sich selbst rühmen kann. Ein Gekreuzigter ist eine Schande. Doch diesen Gekreuzigten hat Gott einst bei seiner Taufe als geliebten Sohn angesprochen. Und dabei ist er geblieben. So kann Paulus die Linie vom unansehnlichen Kreuzestod in die Schattenseiten als die Lieblingsseiten Gottes ziehen. Gott liebt das, was alle meiden. Gott liebt seltsam, geradezu provokant und skandalös aus Sicht der „Sauberen“ und „Perfekten“.
Diese Wortpassage hat in mir eine große Resonanz ausgelöst. Ich hatte geradezu Herzklopfen. Ich kann nicht genau sagen, warum das so war. Ich ahne aber, dass Paulus den Nerv einer Kultur trifft, die sich aufbläht, weil ihre Exponenten meinen, sie seien die Tollsten auf dieser Erde. Paulus zeigt mir damit auch meinen Standort. Und ich hoffe, das mein Standort auch zu meinem Standpunkt wird, wenn es draufankommt, im Sinne des Paulus zu agieren.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
15.1.25
„Du sollst nicht ehebrechen.“ Das ist die heutige Losung aus 2. Mose 20,14. Meine erste Begegnung mit diesem Gebot hatte ich als Jugendlicher. Ich musste als Konfirmand die 10 Gebote auswendig lernen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich hab´s halt gemacht. Es hat mich auch nicht berührt oder angesprochen. Das hatte nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Ich hatte noch nicht mal ein Mädchen geküsst. Und außerdem kann ja niemand die Ehe brechen, der nicht verheiratet ist. Aber so weit gingen meine Gedanken damals nicht. Als ich die vier Worte jetzt wieder so unvermittelt las, waren sie für mich wie ein Hammer. So sollte man das nicht machen. Deshalb möchte ich die vier Worte, die man ad hoc als alternativlosen Befehl missverstehen kann, einordnen. Dabei will ich mich an Jesus orientieren. Es ist ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern überliefert, in dem es um die Scheidung einer Ehe ging (Matthäus 19). Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wie er zur Scheidung steht. Mit einer Gegenfrage prüfte er die Thorakenntnis der Pharisäer und wollte von ihnen wissen, was Mose dazu sagt. Die Pharisäer kannten sich aus und zitierten richtigerweise 5. Mose 24,1. Dort steht: „Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt…“ Dass ein Mann seiner verheirateten Frau einen Scheidebrief ausstellen kann, weil ihm irgendetwas an ihr nicht passt, war für damalige Verhältnisse ein Fortschritt. Der Mann hätte die Frau auch einfach wegschicken können. Durch das Schriftstück wurde die geschasste Frau geschützt und konnte eine neue Ehe eingehen. Ohne das Schriftstück wäre ihre Existenz gefährdet gewesen. Diese Regelung des Moses war zwar frauenfreundlich, legitimierte letztlich aber die Ehescheidung. Jesus lehnte diese Regelung ab. Was er dazu sagte, kann als authentisch verstanden werden. Er verbietet beides: die Ehescheidung und das Ausstellen eines Scheidebriefes. Dass Mose das angeboten hat, versteht Jesus als Zugeständnis bzw. Kompromiss für die Hartherzigkeit der Menschen. Jesus sagt: sich scheiden zu lassen bedeutet, dass die Frau bei ihrer neuen Heirat die eigentlich immer noch gültige Ehe bricht und wer eine geschiedene Frau heiratet, bricht damit die ursprüngliche Ehe. Wie kommt Jesus dazu, das zu behaupten? Er bezieht sich auf die Schöpfungserzählung, wo es heißt: „Und Gott der Herr machte eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bei von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch…Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch.“ (1. Mose 2,22-24) Der Schöpfungswille Gottes ist also der Hintergrund des strengen Eheverständnisses Jesu. Er selbst war ja nicht verheiratet, vielleicht deshalb, weil er die Thora derart stringent auslegte? Jesu Meinung war: Gott sah ursprünglich vor, dass Mann und Frau zu einem Fleisch gemacht werden. Für ihn war klar: Was Gott so grundlegend zusammengefügt hat, das soll und kann der Mensch gar nicht trennen. Und das bedeutet, dass jede neue Ehe, die eingegangen wird, die eigentlich immer noch bestehende erste Ehe bricht. Das bedeutet für Jesus, dass die Menschen ganz grundsätzlich hinter dem zurückbleiben, was Gott in der Schöpfung grundgelegt hat. Er will den ursprünglichen Schöpfungswillen wieder zur Geltung bringen. Das hat seinen Fluchtpunkt darin, dass Gottes Herrschaft bald anbrechen wird. Gottes Wille soll nach Jesu Vorstellung wie im Anfang wieder zur Geltung kommen. Und dahinter, sagt er, bleibt die Moseregelung mit dem Ausstellen eines Scheidebriefes weit zurück. Deshalb lehnt er sie und damit die Ehescheidung ab.
Für heutige Menschen mag das fremd und weit weg sein. Im Sinne Jesu ist es aber zu überlegen, was eine Ehe noch sein kann außer einer Liebe, die sich darin ausdrückt und aufblüht, Kinder großziehen, gegenseitige Versorgung und das Erleben eines gemeinsamen Lebensweges in Freud und Leid. Im Sinne Jesu hat eine Ehe einen göttlichen Mehrwert: Die Verheirateten leben so, wie es Gott im Anfang gemeint hat, das heißt, sie verstehen ihre Ehe aus dem Schöpfungswillen Gottes heraus, grundgelegt für ein gelingendes Leben wie Gott zuvor die Grundlagen für das Leben erschaffen hat, in das hinein er die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und dieses Göttliche sollen sie ehren und nicht aufs Spiel zu setzen.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
14.1.25
„Was habe ich davon?“ Die Frage ist berechtigt und Jesus hat sie nicht abgewiesen. Petrus hatte ihn gefragt: „Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt; was wird uns dafür gegeben?“ (Matthäus 19,27) Jetzt ist man auf die Antwort Jesu gespannt. Er gibt Petrus recht und sagt dann, dass es eine Belohnung geben wird und diese Belohnung wird in etwa dem hohen Preis entsprechen, den die zahlen, die alles hergeben, um ihm nachzufolgen: Geld, Besitz, Status, Erfolg, Berufsleben, Familie, Freunde, Verwandte – die also freiwillig bereit waren, alles aufzugeben, um ihr Leben komplett Jesus anzuvertrauen. Die Antwort Jesu kann also nur aus seinem Besitzstand heraus erwartet werden. Sein Besitz ist die immaterielle Welt. Zu seinen Jüngern sagte er sinngemäß: Wenn die Einheit des Volkes Israel wieder hergestellt sein wird, die 12 Stämme, aus denen es hervorgegangen ist – wenn Israel nicht nur wieder ein intaktes Volk, sondern auch als Volk Gottes neugeboren sein wird, dann werdet Ihr mit mir an der Spitze dieses Volkes stehen. Dann wird der, der das Volk gesammelt, aufgerichtet und geheilt hat, der oberste Herrscher sein, der Messias Gottes und ihr werdet jeweils einem der 12 Stämme vorstehen und sie leiten wie es der Messias macht. Mit Messias meinte Jesus sich selbst. Das also ist der Lohn für die nackte Existenz eines Erdenjüngers, dass er einst eine Führungsposition einnehmen wird. Wo der Jünger heute mittellos ist und von der Hand in den Mund lebt, wird er dort eine angesehene und verehrenswerte Person sein. Der Lohn kann nicht gegenüber dem irdischen Nachfolgeleben gegengerechnet werden, gefühlt aber überwiegt er bei weitem. Beim zweiten Teil seiner Antwort an Petrus bezieht sich Jesus auf ein tragisches Erlebnis. Es kam ein Milliardär zu ihm – das wären heute Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos oder auch ein weniger bekannter Milliardär aus Deutschland oder Saudi-Arabien sein. Dieser stinkreiche Typ merkte, dass ihm sein Reichtum nur die Krise der Überdrüssigkeit bescherte. Ein Leben voller Annehmlichkeiten war ihm nicht mehr gut genug. Er wollte jetzt das ewige Leben. Im Schema seines bisherigen Lebens fragte er Jesus, was er tun muss, damit er das ewige Leben bekommt. Jesus durchschaute ihn, gewann ihn sogar lieb und sagte dann: „Verkauf alles! Gib´s den Armen! Dann folge mir nach!“ (heutiger Lehrtext aus Matthäus 19,21) Sprich: das Immaterielle gibt es nur im Tausch mit dem Materiellen. Tragisch wurde die Begegnung dadurch, dass der Reiche merkte, dass er es nicht konnte. Er blieb ein Gefangener des Materiellen. So ging er traurig von Jesus weg. In der Antwort auf Petrus nimmt Jesus diese Begegnung auf und sagt: Wer alles und alle wegen mir verlässt, der wird überproportional beschenkt werden mit einem Leben, das nicht endet. Das hört sich nach Zukunft an. Aber ich verstehe es präsentisch. Ein Leben mit Christus, dem Auferstandenen, also dem Ewigen ist das ewige Leben, also das Leben mit dem Ewigen – mit Christus. Damit ist die Nachfolge gemeint. Ich verstehe es so, wie es Bonhoeffer in seiner „Nachfolge“ schreibt. Es passt nichts zwischen den Nachfolgenden und Christus. Die beiden sind eins. Sie bleiben unzertrennlich in Zeit und Ewigkeit.
„Was habe ich davon?“ In der Antwort Jesu an den Reichen liegt ein spannender Gedanke: Jesus nachfolgen ist die Vorstufe oder die erste Etappe auf das Leben mit ihm in der immateriellen Welt. Sich in die Nachfolge Jesu Tag für Tag einüben mit allem Besitz, den man sich erwirbt und allen Beziehungen, in denen man lebt und auf die man nicht verzichten kann, bedeutet für mich: Vorbereitet sein für den Ernstfall. Ich möchte mich am Ende meines Lebens auf den Lohn freuen und davor nicht zu denen gehören, die Jesus verraten oder verleugnen. Von ihm unvermittelt in eine Aufgabe gerufen werden, zähle ich auch zu einem Ernstfall.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
13.1.25
Der längste aller Psalmen ist der 119. Er umfasst 22 Strophen nach jedem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Er erhebt also Anspruch auf Vollkommenheit. Obwohl so lang hat er doch nur ein Thema: die Thora=Gottes Weisung und Wort, seine Zeugnisse, Ordnungen, Satzungen, Gebote und Rechtssätze, was umschreibt, worum es geht: Hilfe zum Leben. Der längste Psalm ist die längste Liebeserklärung an Gott, die es gibt. Denn er will, dass das Leben gelingt. Diesem Gelingen entspringen all die „Warnhinweise“, die in Psalm 119 eingespeist werden: hüte dich vor Habsucht (V36), oberflächlichen Erklärungen (V37), Spott und Selbstsicherheit (V51), Perversion der Wahrheit (V69), Uneinsichtigkeit (V70). Stattdessen plagt es den Psalmbeter geradezu bei dem Gedanken, seine Liebe zu dem, was Gott sagt und will, könnte nicht groß und überschwänglich genug sein und er könnte gar etwas anderes wichtiger finden. Er will voll und ganz auf dem Weg der Thora gehen und auf ihm bleiben. Das drückt die heutige Losung aus: „Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen.“ (V37) Darum bittet er seinen Gott. Als nichtig wird das verstanden, was einen Menschen verwirrt und darum in ein instabiles Leben führt. Die Thora wurde für ein gelingendes Leben geschrieben. Und das ist ein Leben, das in drei Dimensionen gelingen soll: mit sich selbst, dass man also mit sich im Reinen ist oder ins Reine kommt; mit den anderen und mit Gott, dem man alles zu verdanken hat.
Es darf hier in keinster Weise auch nur der leiseste Verdacht aufkommen, dass diese Liebe zur Thora erzwungen wäre oder einengen würde. Auch ist der Mensch, der sein Leben im Geist der Thora lebt, kein Miesepeter. Er ist ein mit weitem Herzen Liebender. Deshalb darf man die Thora auch nicht in einen Gegensatz zum Evangelium setzen, was oft leichthin so verstanden wird, dass der erlöste Christ auch von der Knebelung durch das Gesetz befreit wäre. Das zu tun wäre fahrlässig und nicht zielführend. Die Thora ist deshalb liebenswert, weil sie dem Leben dienen will. Wenn Menschen daraus ein unterdrückendes Gesetz machen, ist das ihr Werk aber nicht die Absicht Gottes.
Es gilt also zweierlei für Christen zu bedenken: Zum einen die Liebe der Juden zur Thora und sich selbst zu fragen: Was in meinem Glauben hat eine so weitreichende Wirkung auf mein Inneres und meine Lebensgestaltung wie die Thora für einen Juden? Ein ehrlicher Austausch zwischen Juden und Christen wäre hier sehr aufschlussreich.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
12.1.25
Endlich Sonntag! Der Sonntag ist nach christlichem Verständnis der erste Tag der Woche. In der christlichen Tradition beginnt also die Woche mit einem Feiertag. Kern des Sonntags ist die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu von den Toten. Deshalb wird der Sonntag in anderen Ländern auch „Tag des Herrn“ genannt. Die Tage, die dem Sonntag folgen, beziehen sich auf die entscheidenden Tage im Leben Jesu. So ist der Donnerstag der Gründonnerstag („grün“ kommt vom Mittelhochdeutschen „greinen“=“weinen“), der Freitag ist der Karfreitag und der Samstag ist der „stumme Tag“, der Tag des Schweigens, der in den Osterjubel mündet, der am Sonntag erklingt. Heute am 1. Sonntag nach Epiphanias wird in den Gottesdiensten der Evangelischen Kirche ein Textabschnitt aus dem 1. Korintherbrief ausgelegt (1,26-31). Der Apostel Paulus schreibt:
Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist, auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. 30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf dass gilt, wie geschrieben steht: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!
Auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm wird dieser Text zu hören sein. Ich gebe davor eine Anleitung, wie man sich (nicht nur) diesen Text aneignen kann.
11.1.25
„Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der kommt.“ (Offenbarung 1,4; heutiger Lehrtext) Nachdem sich der Schreiber der Offenbarung vorgestellt hat, fällt er nicht gleich mit der Tür ins Haus. In seinen sieben Sendschreiben an die Gemeinden in der römischen Provinz Asia, der reichsten im Römischen Reich damals, geizt er weder mit Kritik noch mit Lob. Er stellt dem aber, was er tun muss, was voraus. Er grüßt die, die er kritisieren muss und die, die er loben darf mit zwei göttlichen Energien: Gnade und Friede. Das heißt: das, was er ihnen schreibt, hat er im Wirkfeld dieser beiden Energien geschrieben. Gnade ist die Energie, die einem Menschen sagt: Du bist angenommen. Du hast eine Zukunft. Friede ist die Energie, die einem Menschen sagt: Dir soll es gut gehen. Du bist geborgen. Johannes lebt aus dem und durch das, was er seinen Gemeinden wünscht. Das heißt, dass seine Beziehung zu den sieben Gemeinden in der Provinz Asia von diesen beiden Energien geprägt ist. Und deshalb wird die eine oder andere Gemeinde, die er heftig kritisiert, das akzeptieren können. Denn auch im geistlichen Miteinander kann es nicht ohne Kritik und Korrektur gehen. Aber es ist doch immer die Frage, in welchem Energiefeld das gemacht wird. Die Wahrheit braucht die Gnade, sonst zerstört sie. Der Friede hält die Beziehung aufrecht und am Leben. Das gilt es zu beherzigen im kirchlichen Miteinander. Und wer will, kann das auch auf sein eigenes Beziehungssystem übertragen.
Gnade und Friede kommen nicht einfach so aus den Weiten des Universums. Sie kommen von Gott, den Johannes als der bezeichnet, der ist, der war und der kommt. Sprich: er hält die logische Reihenfolge nicht ein. Er spricht von Gott als erstes von dem, der da ist. Also als der Gott, der mit seiner Gnade und seinem Frieden die Gegenwart der Gemeinden prägt und ausfüllt. Und das als der Gott, der er schon immer war, der also die Grundlagen des Lebens auf dieser Erde aus Liebe geschaffen hat. Und als der Gott, der kommt. Und so könnte man sagen, dass Johannes schon etwas ahnte vom Reichtum und Geheimnis des trinitarischen Miteinander von Vater, Sohn und Heiligem Geist.
„Gnade sei mit dir und Friede!“ Mit diesem Gruß, den wir spenden können, nehmen wir uns selbst und die, die wir grüßen, in Gottes Wirklichkeit hinein – so als wären wir in eine warme Decke eingehüllt.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
10.1.25
Oh ja! entfuhr es mir, als ich die heutige Losung las: „Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt.“ (Johannes 13,34-35). Oh ja! Diese Worte Christi haben mir gutgetan, weil sie ein Beziehungsnetz knüpfen zwischen dem auferstandenen Christus und seinen Gläubigen und den Gläubigen untereinander. Und die Liebe ist das Garn, aus dem das Netz geknüpft ist. Das ist zwar ein schönes und treffendes Bild. Das soll´s auch weiter sein. Es verblasst aber fast angesichts der Realität, die Menschen schaffen. Ein Beispiel. Ich lese in der heutigen Ausgabe der Badischen Zeitung auf Seite 5: „Die Sängerinnen und Sänger von Domchor und Domkapelle wollen vorerst nicht mehr im Freiburger Münster singen. Sie erwarten ein Gesprächsangebot durch das Domkapitel.“ Nach der Kündigung des Domkapellmeisters Boris Böhmann und seiner Freistellung nach den Weihnachtsmessen sähe sich die große Mehrheit der Sängerinnen und Sänger nicht mehr in der Lage, „…in der gegenwärtigen Situation aufgrund der Verletzungen, Enttäuschungen und Verunsicherungen bis auf weiteres…an Chorproben teilzunehmen und an der Gestaltung von Gottesdiensten mitzuwirken.“ Es geht um Kinder und Jugendliche. Wieder einmal sind es Erwachsene, die es nicht miteinander auf die Reihe kriegen. Ein jahrelanges Zerwürfnis endete mit einem Richterspruch. Die Diözese zieht gegen ihren Domkapellmeister in Freiburg vor ein Gericht. Oh nein! Wer Recht bekam, steht jetzt in der Gefahr, seine singenden Kinder und Jugendlichen zu verlieren. War´s das wert? Christus setzt einen Zwischenton. Er hört sich so an: Ein zerschnittenes Handtuch ist noch kein zerrissenes Netz. Ich hatte einen Gedanken: Wie wäre das gewesen, wenn sich im Weihnachtsgottesdienst Burger und Böhmann versöhnt hätten – vor einem vollbesetzten Münster! Wenn sie sich in die Augen geschaut und die Hand gegeben hätten! Oh ja! Man kann nicht immer über seinen Schatten springen. Aber es gibt die Möglichkeit, ihn ruhen zu lassen und seiner Bewältigung etwas vorziehen! Wenn man das will! Zwei Männer und so viele begabte Kinder und Jugendliche! Menschenskinder! Jesus hatte nicht nur das Innenverhältnis im Blick, sondern auch das Außenverhältnis („Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid…“). Alle sind in dem Fall alle anderen. Das spürt man diesem Konflikt ab, dass es alle mitbekommen! Und Jesus spricht von Liebe. Der Liebe, die er meint, sind romantische Züge fremd. Es ist die agape. Das ist die Nächstenliebe. Und diese Liebe ist eine sorgende Liebe. Sie hat das Wohl des anderen im Blick, egal wer er ist. Die Kirchenmänner- und frauen – gleich in welcher Konfession und Position – sind sich im Namen Jesu ihre gegenseitige Wohlsorge schuldig. Wer will – vielleicht eine Regierung, eine Familie, ein Ehepaar, ein Bürgermeister mit seinen Gemeinderäten etc. – könnte sich das natürlich auch zu eigen machen. Doch in erster Linie ist das Miteinander in den Kirchen gemeint.
Sich umeinander sorgen. Dafür sorgen, dass es den anderen einigermaßen gutgeht! Hört sich relativ leicht an, kann einem aber, wenn´s darauf ankommt, viel abverlangen. Ich sehe dazu aber keine Alternative. Ellbogen einsetzen kann es im Jesu Namen nicht sein!
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
9.1.25
Was geschah, nachdem Jesus von Johannes im Jordan getauft wurde? Er war in der Wüste. Übersetzt: er war mit sich allein. Ich habe schon mal von einem spirituellen Angebot in einem Kloster gehört. Es hieß: Gönne dir einen Wüstentag! Da war ich skeptisch. Ich dachte: „Wüste“ kann ich mir weder aussuchen noch gönnen. Biblisch gesehen bedeutet „Wüste“ mehr als nur ein geistlicher Shorttrip ins Innere der Seele. Die heutige Losung öffnet die Tür für das, was während eines Aufenthalts in der Wüste geistig-geistlich geschehen kann: „Und alsbald trieb der Geist Jesus in die Wüste; und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm.“ (Markus 1,12.13) Im Matthäusevangelium wird dieser Aufenthalt mit Inhalt gefüllt. Wichtig ist dabei die Zahl 40. Es war eben kein „Wüstentag“, sondern ein Komplettaufenthalt. Kurzum: mehr Wüste als die, die Jesus erleben musste, gibt es nicht. Schauen wir also hin. Dass der Geist ihn in die Wüste trieb, heißt nicht, dass er ihn dort absichtlich in eine Lebens- und Glaubenskrise führen wollte. Das geht aus dem Text nicht hervor. Was aber aus dem Text hervorgeht, ist folgendes: Wo ein Mensch mit sich allein ist, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Radio, also ohne künstliche äußere Reize, tun sich geistig-geistliche Abgründe auf. Zu solchen tiefen Erlebnissen ist der moderne Mensch nicht mehr in der Lage. Er ist zu sehr abhängig von dem Äußeren. Er könnte es nicht loslassen. Er wüsste, dass er völlig auf sich fallen, möglicherweise zusammenfallen würde ohne die Luxuskrücken, die sein schnelles und oberflächliches Leben stützen. So reif ist der Geist des modernen Menschen nicht, dass er auf die Idee käme, sich den Gefahren eines Wüstenerlebnisses auszuliefern. Bei Jesus war es anders. Wie ist das bei ihm abgelaufen? Seine 40-tägige Zeit in der Wüste war fast vorbei – Jesus war sozusagen auf der Ziellinie – da kam der Höhepunkt. Jesus hatte Hunger. Der stellt sich in der Regel nach längerem Fasten ein. Diese körperliche Schwäche war das Einfallstor für den „Versucher“, wie er zunächst genannt wird. Zwei Verse weiter wird er „Diabolos“, der Durcheinanderbringer genannt. Beide Ausdrücke stehen für eine personalisierte Funktion: auf die Probe gestellt oder verwirrt werden. Das geschah in drei Etappen. Erstens: Hast du Hunger? Dann mache die Steine, die hier rumliegen, zu Brot. Antwort: der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Zweitens: Vertraust du Gott? Dann fordere ihn heraus. Antwort: Du sollst Gott nicht herausfordern. Drittens: Willst du die Weltherrschaft? Dann falle vor mir auf die Knie. Antwort: Gott soll man anbeten und ihm allein dienen. Neben dem Komplettaufenthalt in der Wüste ist das eine Komplettversuchung. Jesus wurde physisch (Hunger), geistlich (Gott herausfordern) und geistig (Machtfülle) versucht. In allen drei Fällen hat er mit einem Zitat aus der Thora (5. Buch Mose) dagegengehalten. So profund waren die Thorakenntnisse des Versuchers nicht. Nur beim ersten Versuch zitierte er die Thora. Beim zweiten war es ein Zitat aus Psalm 91. Beim dritten Versuch war die Thora gar nicht mehr im Gespräch. Beim Versuch, Jesus die Weltherrschaft für den Kniefall vor ihm anzubieten, offenbarte der Versucher seine eigentliche Absicht: er will der Größte sein. Er will an der Stelle Gottes verehrt werden.
Ich ziehe daraus zwei Erkenntnisse: Erstens ist es für ein stabiles geistiges und geistliches Leben von Vorteil, bibelfest zu sein. Zweitens erkennt man einen „Diabolos“ daran, dass er größenwahnsinnig ist und es genießt, wenn ihm die Massen huldigen.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
8.1.25
Ich schaue wie jeden Tag in das kleine Buch, in dem die Bibelverse für jeden Tag aufgeschrieben sind. So auch heute. Als ich lese, dass Psalm 108 Vers 2 die Losung für den heutigen Tag ist, ahne ich noch gar nichts. Es heißt da: „Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele!“ Aber dann staune ich nicht schlecht: der Psalm 108 ist eine Zusammenstellung aus Psalm 57 und Psalm 60. Das heißt, der Psalm 108 ist ein zweigeteilter Psalm. Er ist so kunstvoll zusammengestellt, dass man es nicht merkt. Erst wenn man genauer hinschaut und eine schlaue Lektüre zur Hand hat, wird man auf diesen einmaligen Umstand hingewiesen. Ein Stück aus zwei Teilen. Ich sage es genau: die Verse 2-6 von Psalm 108 sind identisch mit Psalm 57,8-12 und die Verse 7-14 von Psalm 108 sind identisch mit Psalm 60,7-14. Das heißt, dass zwei Textstücke aus zwei anderen Psalmen später zu einem neuen Psalm, nämlich Psalm 108, zusammengefügt wurden. Man kann verschiedene Überlegungen dazu anstellen, aber am Ende gibt es keine plausible Erklärung dafür, warum jemand (vielleicht ein Priester?) einen Psalm aus zwei Psalmen zusammengestellt hat. Wenn hinter diesem Umstand eine verstandesmäßige Absicht stand, dann ist es nicht zufällig, dass der Psalm so anfängt: „Fest ist mein Herz, Gott, fest ist mein Herz! Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele!“ Das stammt aus Psalm 57. In ihm wird daran erinnert, dass David sich in einer Höhle verstecken musste, weil der amtierende König Saul ihn töten wollte. Die Botschaft dieses Psalms ist die, dass es selbst in ausweglosen Situationen einen Schutz gibt. Es ist eh so, dass aus dem Kreis von Menschen, die bedrängt und deklassiert wurden, die meisten Klage- und Anklagepsalmen hervorgegangen sind. Der Psalm 60 wiederum ist eine Erinnerung an den Kampf des Königs David gegen ein verfeindetes Volk. Der Psalmbeter gesteht ein, dass er trotz der eigenen militärischen Stärke Gottes Beistand braucht. Diese Bitte geht so weit, dass Gott selbst der sein wird, „der die Feinde niedertreten wird.“ (60,14) In beiden Psalmen geht es letztlich um eine Person: König David. Beides Mal in schwierigen Situationen, deren Ausgang ungewiss ist. In Psalm 57 wird David, schon als König gesalbt, vom amtierenden König Saul verfolgt, muss also um sein Leben bangen. In Psalm 60 muss David als König Krieg führen. Und in beiden Fällen wurde David bewahrt. War das die Motivation, Teile von Psalm 57 und 60 zu Psalm 108 zusammenzufügen? Als wollte der Redakteur sagen: „Schaut auf David! Sein Leben stand oft auf der Kippe. Doch er hat seinem Gott vertraut. Orientiert euch an ihm!“ Das ist wahrscheinlich und da wir die Situation nicht kennen, in die hinein der Psalm 108 zusammengestellt wurde, gilt seine Botschaft jedem Menschen, der nicht weiter weiß und gerade deshalb eine Perspektive braucht.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
7.1.25
„Jesus lehrte mit Vollmacht.“ heißt der heutige Lehrtext. Das sagt alles über Jesus aus. Etwas anderes hätte sich der glaubende Mensch auch nicht denken können, als dass Jesus mit Vollmacht lehrte. Doch es kann nicht ausreichen, das zu erfahren. Ich möchte wissen, in welcher Situation das geschah. Und da wird es brisant. Denn es prallen Gegensätze aufeinander. Jesus hatte seinen Wohnort Nazareth verlassen, um sich von Johannes im Jordan taufen zu lassen. Dort erfolgte über ihm die göttliche Proklamation: „Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Markus 1,11). Nach einem vierzigtägigen Aufenthalt in der angrenzenden Steppe verlegte Jesus seinen Wohnsitz nach Kapernaum am See Genezareth. Das war eine andere Nummer als Nazareth. Beide Orte hatten eine Synagoge, doch die in Nazareth war eher mit einem kleineren Bethäuschen zu vergleichen. In Kapernaum hatte es Jesus mit Schriftgrößen zu tun, nicht mit Laienpredigern wie in Nazareth. Da kam also einer aus dem galiläischen Bergland aus Nazareth, das sowieso keiner richtig kannte, und meinte, er könne in Kapernaum seine Auslegung der Thora verkündigen. Nicht auf der Straße oder auf dem Marktplatz, sondern in der Synagoge. Jesus ging am Sabbath dorthin wie es alle jüdischen Männer machten. Die Reaktion auf seine Auslegung eines Ausschnittes aus der Thora (es wird nicht gesagt, welcher es war) war eindeutig: sie brachte die Zuhörer aus der Fassung. Diese Reaktion wird damit begründet, dass er „mit Vollmacht“ lehrte. Was heißt das? Das griechische Wort „Vollmacht“ hat auch die Bedeutung „volle Freiheit, etwas zu tun“ oder „freie Hand haben“. Das ist eine wichtige Ergänzung. Mit Jesus trat in der Synagoge von Kapernaum nicht nur eine neue interessante Variante der Thoraauslegung auf. Hier trat ein Mann auf, der ungebunden war und sagte, was er dachte. Man merkte ihm an, dass er nicht eine Botschaft verkündigte, sondern dass ER die Botschaft war. Frei und vollmächtig war er, weil zwischen ihn und die Schrift kein Blatt Papier ging. Deshalb konnte man mit ihm auch nicht über seine Lehre diskutieren, wie es Brauch war in der Synagoge und ein kaum zu überbietender Schatz in der Verstandesschärfung des jüdischen Volkes war und bis heute ist. Bei Jesus aber gab es nichts zu diskutieren, weil er das war, was er lehrte. Die anderen waren die „Grammatiklehrer“, wie sie im griechischen Text genannt werden („grammateis“ Markus 1,22). Sie kannten jeden Buchstaben der Thora und so lehrten sie auch die Leute. Sie diskutierten heftig darüber, ob das Iota (der kleinste hebräische Buchstabe) da sitzen muss oder dort. Das Lesen der Thora war zum Grammatikstudium geworden. Jesus aber hatte den Geist der Texte erfasst und der Geist hatte ihn erfasst. Um zu verstehen, was damals in der Synagoge abging, hilft es, das Textverständnis des Bibliologs heranzuziehen. Im Bibliolog unterscheidet man zwei Textfeuer: das schwarze Feuer ist der geschriebene Text, das weiße Feuer ist das, was dazwischensteht. Wenn die Grammatiklehrer von damals keinen Zugang hatten zu den beiden Textfeuern der Thora, war ihr Wichtigstes verloren. Wenn dann einer wie Jesus kommt, der die Textfeuer in sich hat und sie lehrt, dann musste das die Leute aus der Fassung bringen. Das ist auch heute noch so. Die Texte der Heiligen Schrift wollen auf dem Weg Jesu so erschlossen werden, dass sie in uns die Feuer der Erkenntnis und des Glaubens entfachen. Am meisten bringt das, wenn man es mit Gleichgesinnten macht.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
6.1.25
Man müsste sich tagsüber oder abends mal in aller Ruhe hinsetzen, ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand nehmen, nachdenken und sich fragen: Wie viele Rollen habe ich an diesem zurückliegenden Tag eingenommen? Erst fällt einem vielleicht gar nichts oder fast nichts ein. Doch dann, glaube ich, würde sich das Blatt bald füllen mit: Ehemann, Vater, Großvater, Nachbar, Hundebesitzer, Privatier, Gesprächspartner, Arbeiter, Hausbesitzer, Autofahrer, Einkäufer, Witwe etc. Wenn man das hat, könnte man sich die Mühe machen aufzuschreiben, was man in diesen Rollen gedacht, getan, entschieden, gelassen und verändert hat. Ein dritter Schritt wäre, den Gefühlen nachzuspüren, die in den jeweiligen Rollen auftraten zB: Wut, Trauer, Empathie, Gehetzt sein, Eile…Das wäre ein lohnendes Unterfangen, um sich dann zu fragen: Habe ich was vergessen? Und nach einigem Nachdenken könnte sich ein Gefühl ins Bewusstsein schleichen: Wann war ich heute einfach nur ein Mensch? Ein Mensch ohne all die Rollen, die ich einnehmen oder spielen musste? Ich möchte aber nicht so verstanden werden, dass ich Rollen negativ oder als Einschränkung sehe. Rollen sind wichtig, weil sie schützen. Ich kann mich nicht jeden Tag neu erfinden. Deshalb geben Rollen auch ein Stück Heimat und Sicherheit. Ich will mich bestimmten Menschen auch nicht „offenbaren“. Dennoch bleibt am Ende eines Tages die Sehnsucht: Wo kann ich Mensch sein? Da fällt mein Blick auf die heutige Losung aus Psalm 23: „Gott weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.“ (Vv 2+3) Da, wo diese Worte entstanden, ist die Steppe die beherrschende Landschaft. Eine satte Wiese ist die Ausnahme ebenso dass es regnet oder eine Quelle frischen Wassers sprudelt. Dass es Gott mit dem Psalmbeter damals und mit uns heute so meint, wirft ein helles Licht auf sein Wesen. Er will, dass es uns gut geht und es uns an nichts fehlt, was uns Mensch sein lässt. Ich empfinde diese Worte so, dass ich mein Menschsein aus Gottes Güte und Sorgen für mich verstehe. Gott gibt mir das, was ich brauche, um sein zu können, wer ich bin. Der Psalm 23 gibt was Besonderes her für unser Mensch sein. Denn wir brauchen Räume, in denen wir das sein können, ohne etwas befürchten zu müssen. Der Psalm 23 beginnt mit einem Selbstgespräch „Der Herr ist mein Hirte…“ und mündet unvermittelt in ein Gebet ein „Denn du bist bei mir…“, um zum Schluss wieder über in das Selbstgespräch einzumünden „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen…“ Das heißt, dass das Selbstgespräch und das Gebet diese beiden Räume sind, in denen wir mit uns selbst und mit Gott absolut intim sein können. Was wir da denken und reden, geht nur Gott was an, sonst niemanden. Noch eine kleine Beobachtung zum Abschluss: ins Gebet mündet der Psalm, als sich der Psalmist seiner dunklen Täler bewusst wird und dass ihm dort Gefahren lauern, wo er Angst hat und dann Gott als den anspricht, dessen Führung er sich anvertraut und der ihm reichlich auftischt.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
5.1.25
Grundlage: Matthäus 2,1-12
Liebe Gemeinde,
zurück auf Anfang. Wie heißt es da? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde – kurzum die Wirklichkeit, in der wir leben. Und wie wird jedes ausgesprochene Werk, das Gott tat, abgeschlossen, damit uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt und die Erde uns trägt? Es wurde Abend und Morgen. Der Tag nach biblischem Verständnis besteht also aus Abend und Morgen, aus Dunkelheit und Helle. Der Tag beginnt mit dem Abend. Wenn man jemandem also einen „Guten Tag!“ wünschen möchte, dann sollte man ihm das sagen, wenn er ins Bett geht. Das hat einen tiefen Sinn: das Licht wird im Dunkeln ersehnt. Wir gehen nicht vom Licht ins Dunkle. Wir gehen nach biblischem Verständnis immer vom Dunkel ins Licht, nicht umgekehrt. Ein zentraler Satz der Bibel heißt: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Das Dunkel macht ohne Licht gar keinen Sinn. Aber das Licht braucht das Dunkel nicht. Es wurde Abend und Morgen. Der Tag beginnt. Da ist uns leider was verloren gegangen. Wenn wir das Dunkel nicht mehr würdigen, dann geht uns der Trost verloren. Mir fällt auf, dass im Fernsehen viel für Melatoninprodukte geworben wird. Die sollen beim Ein- und Durchschlafen helfen. Offenbar ist der helligkeitsüberflutete Mensch nicht mehr in der Lage, in das Dunkle hinein zu schlafen. Er kann nicht mehr vertrauen, dass ihm im Dunkeln beigestanden wird, dass eine Hand ihn beschützt, dass ihm nichts passieren, dass er sich einem Höheren überlassen kann. Schlafen heißt ja, die Kontrolle verlieren, nichts machen können. Wir atmen ohne Zutun ein und aus. Der Abend aber, der die Nacht einleitet, ist eine Trostquelle. Ich bin als Kind mit diesem Lied von meinen Eltern in die Nacht gesungen worden:
Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt; denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag, der lässt keinen einsam sein, weder Nacht noch Tag. Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun, tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn. Wenn dein Aug ob meinem wacht, wenn dein Trost mir frommt, weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt. Diese Worte hat Rudolf Alexander Schröder 1942 geschrieben.
Vor knapp zwei Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Wie gesagt Weih-Nacht nicht Weih-Tag. Das Kind, das das Licht der Welt wurde, wurde in der Nacht geboren, quasi in die Nacht hinein. Das Kind, von dem es am Ende seiner Geburtsgeschichte heißt: Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. (Lukas 2,21) Da erst weiß man, wie das Kind heißt und dass Jesus ein Jude war und wie alle anderen jüdischen Jungen nach acht Tagen beschnitten und damit in das jüdische Volk aufgenommen wurde. Und das wird mit jüdischen Buben bis heute so gemacht. Wer wie wir an Weihnachten die Geburt eines Kindes feiert, feiert den Beginn eines Lebens. Das Christentum ist die einzige Religion weltweit, die das macht. Und deshalb muss man fragen: Was passiert eigentlich nach Weihnachten? Oder anders gefragt: Was wurde aus dem Kind in der Krippe? Wo ist es aufgewachsen? Was hat es gelernt? Was hat es geglaubt? Sprich: Weihnachten ist der Beginn eines Lebensweges und welchen Sinn macht ein Geburtstagsfest ohne Bilder und Erzählungen des Menschen, der geboren wurde und aufgewachsen ist?
Doch jetzt hat man den Eindruck, dass Weihnachten weggeräumt wie alsbald diese Krippe hier und der Weihnachtsbaum, der mal Christbaum hieß und all die anderen ausgedienten Weihnachtsbäume, die in den kommenden Tagen von Jugendlichen eingesammelt werden. Was das Weihnachtsfest betrifft, ist Jörg Zink folgender Meinung: „Es ist lange her, dass die Tage des Advent Tage der Stille waren, in denen man einen inneren Weg Schritt um Schritt bedächtig ging durch die kürzer werdenden Tage und die langen Nächte auf die eine Stelle, die Krippe, in der man mitten in der Dunkelheit das Mysterium empfing. Es ist, als wäre das Heilige, das Geheimnis, verloren, überflutet von Lichtern und überlärmt von Worten, überrannt von rastloser Leere, vom Gerede über das Fest. Das Fest aber, das eine Quelle der Kraft war, ist wohl nur noch die Stunde, die anzeigt, dass die Kraft zu Ende ist.“ (12 Nächte S. 8) Das hat er vor 30 Jahren so wahrgenommen.
Zurück auf Anfang. Das Entscheidende geschieht in den Nächten, die auf die Weih-Nacht folgen. Es wird ja nicht einfach hell nach Weihnachten. Die Nächte sind immer noch lang und es gibt mehr Dunkel als Helle. In einem Lied von Jochen Klepper heißt es: Gott will im Dunkeln wohnen. Warum? Weil er es hell machen kann. Ursprünglich war der 6. Januar das Datum für Weihnachten, also der morgige Tag. Man hat es dann auf den 25. Dezember gelegt, also nicht auf den 24. So wurde aus dem 6. Januar das Fest der Heiligen Drei Könige.
Eine brisante Geschichte, die wir da vorhin gehört haben. Da kommen Leute aus einer, wie wir sagen würden, primitiven Religion. Sie beschäftigen sich mit Astrologie. Sie sehen eine Erscheinung am Himmel, gehen der Sache nach und erkennen: Da muss bei den Juden etwas Bedeutendes geschehen sein. Ihre heidnische Naturreligion führt sie durch die Nächte, einer Sternenkonstellation von Jupiter – Saturn im Zeichen der Fische folgend, bis ihnen, nach hunderten Kilometern in Jerusalem angekommen, irgendein Schriftgelehrter oder Priester etwas Genaueres sagen kann. Es gibt also einen Weg, der umgekehrt läuft als der Weg der Mission. Die Männer haben in ihrer fremden Naturreligion ein Zeichen von Gott empfangen, und ehe irgendein Zeitgenosse unter den Priestern in Jerusalem etwas von Christus wissen konnte, fragten sie nach ihm und kamen bei ihm an. Der Stallgeruch war ihnen genehm. Es waren Magier, hoch gebildete und angesehene Männer. Das bedeutete damals etwas sehr Genaues: ein Magier war ein Angehöriger der parthischen Priester- und Richterkaste. Das Wort bedeutet „Träger eines Bundes mit Gott“. Sie waren in Babylon zu Hause und kannten sich am Himmel aus. Sie folgten einem Stern und sie wussten, was es bedeutete, wenn er stillstand wie er es damals über Bethlehem tat. Und sie brachten die Gaben ihres Landes. Gaben, die wir nicht haben: Gold, Weihrauch und Myrrhe – eines Königs würdig. Wir täten also gut daran, mit fremdem Wissen, fremder Erfahrung und fremden Glaubensweisen behutsamer umzugehen, ehrfürchtiger, freundlicher und weniger rechthaberisch. Wenn der Gott, an den wir glauben, die Herzen erforscht, dann hört er auch das Gebet eines Menschen, der zu einem anderen Gott betet – in Babylon damals und in Bahlingen heute. Der Gott der Bibel, an den wir glauben, ist der Gott aller Menschen. Der Evangelist Johannes sagt, das göttliche Wort erleuchte als das wahre Licht alle Menschen, die in diese Welt kommen. Lassen wir also offen, auf welche Weise Gott, der in Christus Mensch wurde, zu anderen Zeiten, anderen Völkern, anderen Menschen und Kulturen redete, redet und reden wird.
Wenn uns die Geschichte von den heiligen drei Königen doch dazu bewegen könnte, die Religion anderer Völker geschwisterlich anzunehmen wie Jesus selbst die Menschen seiner Zeit und seines Landes angenommen hat und uns, so glauben wir, annimmt und annehmen wird. Was immer bisher an religiösem Verstehen und Erfahren geschehen ist, das geschah nicht ohne Gott. Das sagt die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Ihre Geschichte sagt uns: ein menschliches Miteinander gelingt, wenn wir uns gegenseitig bereichern.
AMEN
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
4.1.25
„Hände“ und „Geist“ sind die beiden bestimmenden Begriffe in der heutigen Losung aus Psalm 31: „In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott!“ Wer sagt das? Ganz bestimmt niemand, der im wohlig temperierten Wohnzimmer auf der Couch sitzt und bei einem Glas Rotwein den Tag ausklingend lässt und sich überlegt, welches Schleifchen er um diesen Tag legen würde und ihm da die Idee käme, Psalm 31 zu zitieren: „In deine Hände, mein Gott, lege ich meinen Geist.“ Möglicherweise ist der Geist dieses Menschen schon etwas eingetrübt, aber das ist nicht die Situation, in der diese Worte gesprochen wurden – oder geschrien, gehaucht, gestöhnt, gestammelt? Wer weiß das schon. Eine Ahnung bekommt man dadurch, dass es genau diese Worte waren, die der leidende Christus als letzte am Kreuz geschrien hat (Lukas 23,46). Der Schrei, den Jesus diesen Worten beilegte, war nicht zu überhören. Dafür steht im griechischen Text „mega“. So als hätte Jesus in ein Megaphon geschrien. Er ist also nicht leise gegangen. Er ist laut gegangen. Und mit was für Worten! Er hat sie sich nicht ausgedacht. Er hat sie auswendig gekannt. Er hat sie als heranwachsender Jugendlicher in der Synagoge immer wieder gehört und gelesen und verinnerlicht. Und wohl dachte er niemals, dass er in die Situation des Psalmbeters geraten und er seine Worte würde brauchen können, weil er keine eigenen Worte mehr hatte. So leer war er. Wer sagte und sagt diese Worte auch heute? Menschen, denen Leid zugefügt wird. So großes Leid, dass es sie annähernd um ihren Verstand bringt. Menschen, die zu Opfern gemacht werden und sie verstehen nicht, warum das mit ihnen gemacht wird. Ihre Umgebung ist ein einziges Minenfeld. Im Psalm 31 wird die soziale Isolation des Psalmbeters so beschrieben: überall lauern Fallen auf ihn, es wird an Götter geglaubt, die keinen Halt geben, er hat keinen Boden mehr unter seinen Füßen, er ist in Not geraten, er steht in Gefahr, in die Hände der Feinde zu geraten. Was das mit ihm macht, steht in den folgenden Versen: er lebt in Angst, er sieht nicht mehr klar vor Kummer und Gram, seine Lebensgeister sind erloschen, psychisch wie physisch. Er ist für seine Umgebung zum Spott geworden, die Nachbarn und Bekannten lassen ihn hängen; wenn er gesehen wird, laufen die Leute weg. Er fühlt sich wie ein Toter, weil ihn niemand wahrnimmt und ihn alle vergessen. Er sieht sich selbst wie ein gebrochenes Gefäß und seine Feinde beraten, wie sie ihn töten können. Ihm ist nichts geblieben außer einem Raum, in dem er geschützt ist: das Gebet. Hier dringt niemand ein. Hier kann er sein Herz ausschütten. Hier kann er noch sein, der er ist – von Gott gesehen und angesehen. IHM kann er alles erzählen und ihn kann er um Rettung bitten. Das Gebet ist sein Asyl, sein Schutzraum. Der „Geist“, den er in Gottes Hände legen will, ist zu verstehen als ausdauernde Willenskraft. Hebräisch „ruach“, was in der Regel mit „Geist“ übersetzt wird, kann nur aus der Kommunikation Gottes mit dem Menschen recht verstanden werden. Dass ein Mensch als „ruach“ lebendig ist, das Gute will und in Vollmacht wirkt, kommt nicht aus ihm selbst. Diese Lebendigkeit kann von einer feindseligen Umgebung kaputt gemacht werden, sodass ein Mensch nur noch sagen kann: „Ich kann nicht mehr. Den Rest von Leben lege ich in Gottes Hände.“ Von Uwe Seidel (1937-2007) stammt folgende Aktualisierung des Psalm 31 (in Auszügen): „Sieh, Herr, sie legen Stricke aus und wollen mich fangen. Gehe ich rechts herum, so stempeln sie „rechtsradikal“. Biege ich links ab, so schreien sie „Anarchist“. Suche die „goldene Mitte“, so erledigen sie mich mit einer Handbewegung „liberaler Hund“. Sie sagen: „Jeder kann seine Meinung frei äußern!“ In Wirklichkeit aber diskriminieren sie den, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Du Herr, haßt alle, die dieser Diktatur der Schubladenurteile nachlaufen…In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Verstand…Meinen Verstand hast du geschliffen wie ein scharfes Schwert. Mein Herz ist stark und unverzagt. So kann ich es mir leisten, eine eigene Meinung zu vertreten.“ Diese Auslegung ist über 40 Jahre alt und wieder ziemlich aktuell. Wenn es dir ähnlich geht, verzweifle nicht. Fliehe in den Raum des Gebets. Du wirst ihn gestärkt verlassen, um standhalten zu können und der zu sein, der du sein willst.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
3.1.25
Mit einem Tipp liegt man in geistlichen Angelegenheiten voll daneben. Wenn ich mit diesem Begriff einmal durch das gehe, was ich von der Bibel verstanden haben – und das ist nicht wenig! – dann geht es da nicht um Tipps, sondern um klare Ansagen. Bei Jesus fällt einem das geradezu ins Auge. Drei Beispiele. Petrus. Jesus hatte erkannt, dass sein Weg nach Jerusalem ihn direkt ins Leiden führen wird. Das teilte er seinen Jüngern mit. Da erdreistete sich Petrus, zum einen Jesus auf die Seite zu nehmen und zum zweiten ihm zu sagen, dass er davor doch bewahrt bleiben möge. Jesus reagierte überhaupt nicht verständnisvoll. Er fuhr Petrus an mit einem Wort (griech.: opiso), das man am besten so übersetzt: „Hinter mich!“ Was so viel heißt wie: „Reihe dich ein!“ Der reiche Kaufmann. Er kam zu Jesus, um ihn zu fragen, wie er das ewige Leben bekommen kann. Jesus merkte, dass er es ernst meinte. Immerhin hatte er sich ernsthaft bemüht, die Gebote zu erfüllen. Jesus sagte geradeheraus: „Verkauf deinen Reichtum und gib ihn den Armen! Dann kannst du mir nachfolgen!“ Bartimäus. Blind. Er hatte nur einen Wunsch: sehen können. Als er Jesus kommen hörte, machte er schreiend auf sich aufmerksam. Jesus ließ ihn zu sich bringen und fragte ihn: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ (Mk 10,51) Dann äußert er seinen Wunsch, sehen zu können, und Jesus sagte: „Geh hin!“ Und er konnte sehen. Diese drei Beispiele zeigen, dass man mit einem Tipp in geistlichen Dingen voll daneben liegt. Sollte Jesus etwa zu Petrus sagen: Ich gebe dir einen Tipp! Probier´s mal, dich einzureihen! Oder sollte Jesus zu dem Reichen sagen: Du könntest es mal mit dem Teilverkauf deines Reichtums probieren. Dann können wir ja noch mal über alles reden! Oder zum Blinden: Ich habe einen Tipp für dich. Geh deinen Weg. Du schaffst das schon! Auch Ratschläge haben im geistlichen Bereich nichts zu suchen. Schon allein, weil sie so heißen. Wo sie dennoch erteilt werden, schlagen sie den Adressaten zu Boden. Wie dieser: Gott legt einem Menschen nur so viel auf, wie er tragen kann. Der Ratschlag dahinter: Mach nicht so ein Ding darum, dass dein Mann gestorben ist und deine Tochter nächstes Jahr erblinden wird! Du kannst das tragen, weil Gott dir das auferlegt. Bullshit! Tipps und Ratschläge gehören nicht in das Miteinander von geistlich gesinnten Menschen. Wohl aber, an Jesus angelehnt, klare Ansagen, denen man abspürt: „Ich bin als Menschen gesehen, der glaubt. Mein Gegenüber lässt mich nicht im Vagen und strapaziert meinen Glauben nicht!“ Neben den Ansagen gibt es noch die Fragen. Aus zwei Fragen besteht die heutige Losung: „Sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten?“ (4. Mose 23,19). Das könnte man spontan als rhetorische Fragen bewerten oder als Fragen, die Gottes Integrität verteidigen. Sind sie aber nicht. Beide Fragen, die hier Bileam an Balak richtet, beziehen sich auf einen Punkt: die Glaubwürdigkeit Gottes. Er tut, was er ankündigt. Er hält, was er verspricht. So gesehen sind das geistliche Fragen, die im Gegenüber eine Resonanz auslösen. Wie bei einem Autofahrer, der vom Beifahrer gefragt wird: „Wie sieht´s hinten aus?“ Und der Fahrer schaut reflexartig in den Rückspiegel. Zu verifizieren, wie glaubwürdig Gott ist, geht nur im Rückblick und bezieht sich auf Erfahrungen mit ihm. Neben manchen Ungereimtheiten, die bei mir noch nicht aufgelöst sind, kann ich sagen: zu Lebensphasen, die mir einiges abgefordert haben, fällt mir der Begriff „Stimmigkeit“ ein. Und das hat mit Gott zu tun. Stimmigkeit – richtig! Da, wo wir im Nachhinein etwas in unserem Leben als stimmig erlebt haben, war Gottes Stimme sanft und leise am Werk!
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
2.1.25
„Die Einfalt des sorglosen Lebens“ betitelt Dietrich Bonhoeffer den Abschnitt, aus dem der heutige Lehrtext kommt: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohl gefallen, euch das Reich zu geben, spricht Jesus.“ (Lukas 12,32) Allerdings setzt das Lukasevangelium einen anderen Akzent als das Matthäusevangelium in der Bergpredigt, die Bonhoeffer in seiner „Nachfolge“ auslegt. Die „Einfalt“ ist dabei ein sorgfältig gewählter Begriff, den Bonhoeffer auf die Jünger bzw. die Jesus Nachfolgenden bezieht. „Einfalt“ versteht Bonhoeffer als innere Haltung der Jesusgläubigen. Ihr Leben ist ein „einfältiges Leben“. Wie zeigt sich das? Bonhoeffer schreibt: „Das Leben des Nachfolgenden bewährt sich darin, dass nichts zwischen Christus und ihn tritt, nicht das Gesetz, nicht die eigene Frömmigkeit, aber auch nicht die Welt. Der Nachfolgende sieht immer nur Christus. Er sieht nicht Christus und das Gesetz, Christus und die Frömmigkeit, Christus und die Welt….Er folgt in allem allein Christus. So ist sein Auge einfältig. Es ruht ganz und gar auf dem Licht, das ihm von Christus kommt und hat keine Finsternis, keine Zweideutigkeit in sich…“ Ein paar Sätze später spricht Bonhoeffer von der „Einfalt des Auges und des Herzens“. Sie weiß nichts als Christi Wort und Ruf. So ist die völlige Gemeinschaft mit Christus der Lebensschatz der Glaubenden. Er ist die Grundlage, auf der alles aufbaut. Alles Weitere wie Geld und Besitz hat sekundären Wert, dem auch die Sorgen unterworfen sind, die Geld und Besitz mit sich bringen. Während die Bergpredigt jetzt zum Einordnen eines „sorg-losen Lebens“ übergeht, verbindet Lukas die Freiheit von der Angst mit der Freiheit von der Besitzgier. Dabei ist zu betonen, dass Jesus selbst keine ablehnende Haltung zu Besitz hatte. Er kann von Freude am Eigentum und am Feiern sprechen, ohne sie zu tadeln (Lukas 15,6.9.22f). Deshalb kann es der Kirche, die sich auf Jesus beruft, auch nicht gleichgültig sein, was und wieviel sie besitzt und wofür sie ihr Hab und Gut einsetzt. In ihrem Umgang mit dem, was ihnen Menschen an Geld und Gut anvertrauen, muss die „Einfalt des sorglosen Lebens“ durchscheinen. Ihre Zukunft ist nicht mit diesem Vergänglichen versicherbar. Es muss für sie ins Licht gerückt sein, „…dass niemand davon lebt, dass er viele Güter hat.“ Im Gleichnis vom reichen Kornbauern (Lukas 12,16-21) wird genau der als Dummkopf bezeichnet, der meint, er könne seinen Besitz als Lebensversicherung gegen den Tod verwenden. Eine Lebensversicherung aber, die sich gegenüber dem Tod nicht bewährt, ist Dummheit. Der Tod ist die Frage nach dem, was bleibt. Wir können unserem Leben nichts an Länge hinzufügen. Das ist das Grundfaktum unseres Lebens. Ich kann das nicht, meine Frau kann das nicht, Olaf Scholz kann das nicht, auch Putin, Musk und Trump können das nicht. Nur der Mensch kann als „weise“ bezeichnet werden, dem diese grundlegende Erkenntnis zum inneren Kompass seines Lebens geworden ist. Er kann um irdische Dinge wie Reichtum und Macht in einer Weise bemüht sein, die als „weise“ anzusehen ist und auf der ein Segen liegt. Die „kleine Jüngerherde“ Jesu ist sich ihrer Lage unter den „Wölfen der Welt“ wohl bewusst. Doch ihr gilt, dass sie nichts und niemanden zu fürchten braucht. Sie trägt ihren unvergänglichen Schatz im Herzen – den Glauben an den auferstandenen Christus. Das Leben mit ihm als Ewigem ist schon das ewige Leben.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
1.1.25
Das neue Jahr ist noch jung, also erst ein paar Stunden alt. Und schon könnte man dieses „Jung sein“ des neuen Jahres mit dem verwechseln, was der Prophet Jeremia gegen seine Berufung durch Jahwe anführt: „Gott spricht: Sage nicht: „Ich bin zu jung“, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete.“ (Jeremia 1,7; heutige Losung). Jeremia gehört mit Jesaja und Ezechiel zu den größten Propheten des Volkes Israel. Seine 40-jährige Wirkungszeit im Südreich Judäa (das Nordreich war 722 v.Chr. von den Assyrern für immer ausgelöscht worden) fiel in die Zeit von 626-587 v.Chr. Seine Berufung, aus der die heutige Losung stammt, kann man mit der des Moses (Ex 3,14ff.) und der des Richters Gideon (Richter 6) vergleichen:
- Jahwe gibt eine Aufgabe.
- Der Berufene antwortet und wehrt sich: Ich kann das nicht. Ich bin nicht geeignet (zu jung; kann nicht reden; komme aus einer unbedeutenden Familie).
- Antwort Jahwes: Ich bin mir dir! Nicht was du kannst zählt, sondern ich handle durch dich!
Bei Jeremia kommt noch einiges dazu. Jahwe klärt ihn darüber auf, dass er ihn schon vor seiner Geburt für das Amt des Propheten erwählt hat. Das heißt, Jeremia hat gar keine Wahl. Es ist für ihn vorbestimmt zu sein, was Jahwe für ihn vorzeiten bestimmt hat. Dann wird Jeremia aber nicht nur ein Prophet unter Propheten. Er wird von Jahwe „über Völker und Reiche gesetzt“ (1,10). Er bekommt von IHM also eine weltweite Aufgabe, der die klassischen Aktivitäten eines Herrschers entsprechen: ausreißen und einreißen, zerstören und verderben, bauen und pflanzen. Dagegen wehrt sich Jeremia, indem er entgegnet, er sei „zu jung“ dafür. Das hebräische Wort „naar“, das mit „jung“ übersetzt wird, kann hier nicht zeitlich verstanden werden, als meinte Jeremia, später könne er, wenn er klüger und reifer sei, das Amt ja übernehmen. Das Wort „naar“ meint aber den nicht zu leugnenden Stand eines Untergegebenen, den es auf jeder gesellschaftlichen Ebene gab. Jeremia meint also, er sei für diese Aufgabe nicht geeignet, weil er nicht über den dafür notwendigen sozialen Status verfügt. Das wiederum lässt Jahwe nicht gelten. Er verspricht dagegen: „Ich bin bei dir.“
Gott Menschen beruft, die von sich behaupten, sie seien dafür ungeeignet. Niemand kann sich Gott anbiedern mit irgendeiner Fähigkeit, die IHN dazu bewegen könnte, diesen Menschen auszuwählen. Wenn Gott beruft, gibt es nur ein Tauglichkeitskriterium: die Untauglichkeit! Damit klar wird: Es sind nicht die Fähigkeiten des Berufenen, die zählen, sondern Gott will durch ihn seine Macht erweisen – auch in diesem Jahr!
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
31.12.24
Ich finde es grade ziemlich dicht alles. Die Feiertage zum Christfest, der Geburtstag vorgestern an einem Sonntag mit einem Gottesdienst, der mich berührt hat, und heute fertig – das Jahr 2024. Einfach so. Einfach so? Wenn morgen die Doppeleins vor der 25 steht – ist das ein Anfang? Oder eine Fortsetzung? Oder werden gleich in den ersten Stunden die „Vorsätze“ zu Grabe getragen? Ich weiß nicht, wie oft mir in den letzten Tagen ein „guter Rutsch“ gewünscht wurde. Dieses Jahr bin ich bei jedem „Rutsch“ zusammengezuckt. Ich will das eigentlich nicht mehr hören. Der „Rutsch“ kommt aus dem Jiddischen „Rosch ha schana“ und meint das „Haupt des Jahres“. Der 1. Januar wird von den Juden als „Haupt des Jahres“ gesehen, als wäre das kommende Jahr ein Körper und was ist ein Körper ohne Kopf? Richtig! Kopflos! Also mache ich mir viel lieber Gedanken darüber, was im kommenden Jahr für mich die „Haupt-Sache“ sein soll und das kann, wenn ich 2024 erinnere, eine Fortsetzung sein. So gesehen ist für mich der Jahreswechsel nur ein Zahlenwechsel aber kein Wechsel in der „Haupt-Sache“, die ich in der Formel „Tief glauben – weit denken – weiter so!“ zusammenfassen will.
Grundlegend für diesen Weg ist die ständige Frage: Wer ist Gott für mich? Was bedeutet er mir? Wo erkenne etwas von ihm? Wo zeigt er sich mir? Bin ich empfangsbereit für ihn? Die Losung für den letzten Tag dieses Jahr nimmt diese Fragen auf und beantwortet sie so: „Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist´s, der uns führet.“ (Psalm 48,15) Von ihm heißt es in Psalm 48, dass er in Jerusalem auf dem heiligen Berg wohnt. Dieser Berg ist „schön aufragend, ist die Wonne der ganzen Welt“. Berge sind und waren Orte, wo sich Gott niederlässt und man ihm begegnen kann. So war Gott da und doch fern, gegenwärtig zwar, aber dem, was die Menschen in den Niederungen „um den Berg herum“ erleben und erleiden, entrückt. „Berg“ stand für Unzugänglichkeit und auch für Unwirtlichkeit. Gegenbild und Gegenerlebnis zum „Berg“ war die „Stadt“. Sie bot Schutz vor Naturgewalten und Feinden. Beides verbindet sich in Psalm 48 in dem Begriff „Stadt mit dem Berg“. Der Psalm hat aber nur ein einziges Thema: Groß ist nicht die Stadt, groß ist Jahwe. Nicht Türme schützen Jerusalem, sondern „Gott in ihren Burgtürmen“ (V 4) ist Bollwerk und Schutz der Stadt. Nicht die Stadt ist unüberwindbar, sondern Jahwe ist es, der die Aggressoren lähmt und zerschlägt „wie ein Oststurm die Tharsisschiffe zerschmettert“ (V 8). Die Schiffe der Phönizier, die bis nach Tharsis in Spanien fuhren, galten als die solidesten und seetüchtigsten Schiffe jener Zeit. Sie brachten einst für den König Salomo „Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen“ (1. Könige 10,22).
Der Stadt Jerusalem ist in der Weltgeschichte Schlimmes widerfahren, ebenso dem Volk der Juden. Der Psalm 48 endet mit einem Trotzsatz, der unerschütterlichen Glauben erahnen lässt: „Der Herr hat Jerusalem fest gegründet für immer.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Staunen wäre angebracht!
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
30.12.24
Im gestrigen Gottesdienst hat unsere Pfarrerin Frau Semper betont, dass mit dem Weihnachtsfest die Weihnachtszeit erst beginnt – mindestens bis 6. Januar und auch darüber hinaus. Das „Fest“ sei quasi der Start für einen Weg, der in die Stille führt, ins Nachdenken und ins Staunen. Wie das eben bei einem Kind ist, das auf die Welt kommt. Man sieht, wie es wächst. Und genau so steht es denn auch im heutigen Lehrtext: „Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war mit ihm.“ (Lukas 2,40) Wer in dem „Gewimmel“ von Weihnachten das Christuskind entdeckt hat, möchte nicht mehr von seiner Seite weichen. Er möchte bei ihm sein, es begleiten und mit ihm den Weg gehen. Er möchte erleben, wie es diesem Kind als erwachsenem Mann ergeht in dem Gewirr der Zeiten mit seinen Hochs und Tiefs – auch damals in Judäa und Galiläa unter Herodes und später unter seinen Söhnen und vor allem unter der Besatzung durch die Römer. Er möchte im Wirkraum Jesu bleiben, sprich: sich nicht mehr aus seinem Einflussbereich entfernen – gleich, was geschehen wird. Dabei ist zu bedenken, was von Jesus gesagt wird: Er wuchs heran, wurde stark, voller Weisheit (griech: sophia=Lebensweisheit) und die Gnade Gottes war mit ihm. Die ersten beiden Ausdrücke benennen sein körperliches Wachsen, der nächste Ausdruck meint sein geistiges Wachsen und der vierte Ausdruck meint das, was sich in seinem Inneren als sein Selbst herausbildete: dass die Gnade Gottes sein Lebensinhalt war. Sein weiterer Werdegang belegt das reihenweise mit seinen Taten und Worten. So war er. So lebte er. So wirkte er. Voller Gnade. Im Griechischen ist der Wortstamm für Gnade derselbe wie für Freude. Wo Gnade wirkt, wird Freude die Menschen erfüllen. Auch das lässt sich aus dem weiteren Wirken Jesu in Galiläa und darüber hinaus reihenweise belegen. Sein gnadendurchwirktes Auftreten bewirkte bei den Menschen Heilung und Perspektive. Und beides war und ist Grund für eine nicht abebbende neue Freude am Leben.
Ich könnte mir ein Weihnachten auch so vorstellen: Es könnten sich an Weihnachten Menschen versammeln, die schon einige Zeit mit Jesus in ihrem Leben unterwegs sind. An seinem Geburtstag könnten sie sich einfach mal von ihrem Leben mit IHM erzählen, wie er sie geprägt, was er ihnen gewirkt und verändert hat. Das könnte ein spannendes Erzählnetz werden und ich bin überzeugt, dass alle bereichert, bestärkt und mit neuem Mut in die Weihnachtszeit – und weiter – gehen würden. Und wer an Weihnachten Jesus als Kind zum ersten Mal begegnet, könnte ermutigt werden, die ersten Schritte mit ihm zu gehen und zu erleben, wie er mit Jesus wächst, stark wird, Lebensweisheit gewinnt und seine Lebensmitte in Gottes Gnade findet. Sozusagen der Beginn eines weihnachtlichen Lebensweges.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
29.12.24
Das nehme ich persönlich! Ich habe mich auf meinen 69. Geburtstag heute vorbereitet. Ich nehme an, dass mich jemand fragen wird: „Was ist dein größter Wunsch für das neue Lebensjahr?“ Ich würde dann antworten: „Dass die Unbekümmertheit die Quelle all dessen bleibt, was ich tue.“ Seit mich Reiner Sans vor 2 1/2 Jahren nach einem Gottesdienst fragte, ob ich „Worthaus“ kennen würde, war das für mich, als würde mich jemand fragen, wo Hinterdupfingen liegt. Ich machte mich sofort daran, dieses „Worthaus“ kennenzulernen. Die Vorträge auf diesem Portal wurden für mich eine Lebensquelle. Es ist, als würde hier auf das, was mich in meinem Leben und Glauben beschäftigt, verstanden, vertieft und ansatzweise beantwortet. So stets reich beschenkt, teile ich das gerne (mit). Es entstanden die monatlichen Worthaustreffen in Bahlingen (sie gehen 2025 ins dritte Jahr) und meine Vortragstätigkeit in der Erwachsenenbildung Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Letztendlich geht auch die Einrichtung meiner Homepage https://ewald-implus.de und seit diesem Jahr mein Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm auf den Impuls von Reiner Sans zurück. Ursula Sans war es schließlich, die mich dazu anstieß, auf meiner Homepage mit geistlichen Impulsen fortzufahren (auf „Tagebuch“). Ich beschäftige mich täglich mit Losung und Lehrtext, schaue deren Kontexte an, lese Sekundärliteratur dazu und schreibe einen etwa 3-minütigen Text, der zeitgleich auf meinem Podcast angehört werden kann. Was heute Losung und Lehrtext sind, berührt mich sehr. Es ist von Wohnen die Rede und damit von Angekommen und Beheimatet sein. „Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für die Jungen – deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.“ (Psalm 84,4) Vor dem Tempeltor in Jerusalem angekommen, stimmt ein Pilger aus vollem Herzen den Lobpreis an auf die lieblichen Wohnungen des Jahwe Zebaoth. Er ist dort angekommen, wo sein Gott wohnt. Der würfelförmige Hinterraum, das Allerheiligste, war durch Halle und Hof vom Volk der Tempelbesucher getrennt: Jahwe war nahe und blieb doch fern, in Dunkelheit und Stille dem lärmigen Treiben enthoben (2. König 8,12). Das Wallfahren zu heiligen Stätten war und ist ein allgemein-religiöses Ritual. Der Pilger des Psalms 84 will nach einem langen Weg auf Zion Gott „schauen“ – dort, wo für ihn die heilige Welt-Mitte ist. Letztlich sehnt er sich, bei seinem Gott nicht nur anzukommen, sondern in seiner Gegenwart Geborgenheit zu erleben. Als der Tempel in Jerusalem 70 n.Chr. von den Römern zerstört wurde, wurde der Ort der Gegenwart Gottes neu verstanden. An die Stelle des Opferdienstes im Tempel tritt die Lesung aus der Bibel: „Wo die Thora (=5 Bücher Mose) herrscht, gelernt und geübt wird, da ist auch die Schechina (=Einwohnung Gottes), das Volk Gottes erleuchtend und heiligend, segnend und beschützend.“ (Schemoth rabba c:23) Dass Zwingli das Wallfahren „nicht nur närrisch, sondern auch antichristlich“ und Calvin es als „offenkundige Gottlosigkeit“ abtat, hat Protestanten nicht gehindert, in Scharen ins Heilige Land zu pilgern oder nach Santiago de Compostela oder Taizé, wie ich es vor 50 Jahren zum ersten Mal gemacht habe. Die heutige Losung aus Psalm 84 kontrastiert zu einer eher bitteren Erkenntnis des erwachsenen Jesus: „Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, so er sein Haupt hinlege.“ (Matthäus 8,20) Dass Jesus das Fehlen einer Behausung beklagt, hat mit seiner Entscheidung zu tun, ganz auf seinen Gott zu setzen. Er hat das Reich Gottes gefunden. Für ihn war es das, was sich für ihn lohnte, gewollt zu werden. Darin ist er mir Vorbild und Ansporn.
In der Schule wurde ich mal von einer Schülerin gefragt: „Was soll mal auf Ihrer Todesanzeige stehen?“ Für die Frage bin ich im Nachhinein dankbar. Ich denke, dass rechts oben stehen wird: „Ein letztes Mal umgezogen.“ Das stünde deswegen dort, weil ich insgesamt 14x Mal in meinem Leben umgezogen bin. Das Sterben wird für mich ein Umzug sein aus diesem vergänglichen und zerbrechlichen Dasein in die ewige Wohnung, die in den Himmeln auf mich wartet. Umziehen hat was mit Verlassen-, Um- und Eingewöhnen zu tun und überhaupt nichts mit Flexibilität.
Als wir vor dreieinhalb Jahren nach Bahlingen zogen, dem Heimatdorf meiner Mutter, hätte ich nicht gedacht, dass uns diese Zeit ein „Zuhause“ schenken würde. Die tiefen, ehrlichen Beziehungen innerhalb der evangelischen Kirchengemeinde sind unser Reichtum geworden. Der Glaubensweg, auf dem ich von suchenden und interessierten Menschen begleitet werde, ist spannend und aufregend.
Deshalb freue ich mich auf das neue Lebensjahr. Bis auf zwei Tage ist es identisch mit dem Jahreskreis. Der Wohnungslosigkeit Jesu eingedenk möchte ich – er sehe es mir nach! – mich an den Vögeln erfreuen, die auf den Mauersimsen oder in den Mauerfugen des Tempels oder in den Lößwänden des Kaiserstuhls ein Beispiel geben von frohgemuter und glückseliger Geborgenheit in der Gegenwart Gottes. Und hat ER nicht gesagt: „Seht die Vögel unter dem Himmel.“? Hat er. Danke dafür!
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
28.12.24
Ich schreibe hier normalerweise geistliche Impulse für jeden Tag. Das wird ab morgen auch wieder der Fall sein. Doch heute, drei Tage nach dem Christfest, noch das hier. Die sogenannte Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine Geburtserzählung. Erzählt wird von Josef und Maria, wo sie wohnten, wie Maria schwanger wurde und was sie und ihren Mann Josef dazu zwang, von Nazareth nach Bethlehem zu gehen. Der Zensus des Kaiser Augustus, der dem ganzen Römischen Reich galt und der erste überhaupt war, bewirkte eine Völkerwanderung ungeahnten Ausmaßes. Josef und die schwangere Maria waren auch davon betroffen. Sie mussten Nazareth in Richtung Bethlehem verlassen. Kein Wunder, dass Bethlehem überfüllt war und das Kind deshalb in einem Stall zur Welt gebracht werden musste, in einer Notunterkunft, in einer Krippe. Das wird in der Heiligen Schrift im Evangelium nach Lukas erzählt. Als in der Christvesper in Bahlingen dann die ersten Worte des Evangeliums gesprochen wurden, konnte ich mich darin beheimaten. Je länger die Lesung dauerte, umso mehr mischte sich in meine Hoffnung eine Befürchtung: Was, wenn auch dieses Jahr der entscheidende Satz fehlen würde, der Satz, ohne den das Ganze keinen Sinn macht? Die Spannung stieg in mir hoch und die Lesung endete abrupt. Wieder einmal, wieder einmal nur das halbe Evangelium. Es fehlte der abschließende Satz: „Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war.“ (Lukas 2,21). Warum wird dieser Satz immer wieder verschwiegen? Ohne ihn machen die Worte davor keinen Sinn, ja auf ihn läuft doch quasi alles hinaus. Dass er weggelassen wird kommt bei mir so an, als wollte man diesen Jesus immer nur als Baby sehen und nicht als heranwachsenden jungen Mann. Das wäre mit einer Geburtsfeier zu vergleichen, auf der man ausschließlich von der Geburt des Jubilars spricht und von ihm als Säugling und nicht wie er aufgewachsen und erzählt, was aus ihm geworden ist. Zudem wird gerade durch diesen letzten Satz die Realität beschrieben: Jesus war Jude. Er wurde wie alle anderen jüdischen Jungen nach acht Tagen beschnitten, also in das jüdische Volk aufgenommen. Und damit verbunden war die Namensgebung. Warum nur wird das immer wieder verschwiegen? Die Institution Kirche ist ihrem Volk die ganze Wahrheit über das „Kind“ schuldig. Wenn sie Weihnachten zu einem Kult um ein „Kind“ macht, verrät sie den erwachsenen Christus. Und so hoffe ich auf das ganze Evangelium im nächsten Jahr.
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Zur Info: Martin Luther hatte eine Bibel, in der es nur Versangaben und noch keine Kapitel gab. Die kamen erst im 17. Jahrhundert. Sprich: noch kurz vor Martin Luther wurde die Heilige Schrift ohne Versangaben gelesen.
27.12.24
Dieser Tage ist mir was passiert. Ich habe meine Weihnachtsbücher angeschaut. Als ich sie betrachtete, ging mir durch den Kopf: „Du hast dich für Weihnachten jahrzehntelang ins Zeug gelegt, Krippenspiele organisiert, Christvesper und Christmetten mit Tiefgang vorbereitet und gehalten, an den Weihnachtstagen Gottesdienste mit besonderen Schwerpunkten gefeiert.“ Ich konnte mir nach über drei Jahren im Ruhestand sagen: „Mehr ging nicht!“ Da stieß ich auf das Buch „12 Nächte“ von Jörg Zink aus dem Jahr 1992. Als ich die ersten Sätze las, spürte ich eine unfassbare Resonanz in mir. Es waren diese Sätze zu Advent und Weihnachten: „Es ist, als wäre das Heilige, das Geheimnis, verloren, überflutet von Lichtern und überlärmt von Worten, überrannt von rastloser Leere, vom Gerede über das Fest. Das Fest aber, das eine Quelle der Kraft war, ist wohl nur noch die Stunde, die anzeigt, dass die Kraft zu Ende ist.“ (S. 8) Im Folgenden behauptet Jörg Zink, dass sowohl die Wochen des Advents als auch das Weihnachtsfest in ihrer tiefen Bedeutung verlorengegangen sind. Und er schlägt vor, die Stille dort zu suchen, wo sie noch intakt ist: in den Tagen danach – in den 12 Nächten vom Christfest bis Dreikönig. Diese Nächte, „…die für viele Generationen vor uns von hoher Bedeutung waren, die zwölf heiligen Nächte…“ (S. 8), führt er im Einzelnen in diesem Buch aus. Ich merkte auf einmal, wie mein Herz höherschlug. Ich hatte das Buch 1994 gekauft und seitdem nie wieder angerührt. Das ist 30 Jahre her. Und in meine Aufregung über die Möglichkeit des Gewinns eines neuen Zeitraums (24.12.-6.1.) mischte sich eine Reihe von Tränen über einen Kampf, der der dahinschwindenden Substanz von Advent und Weihnachten gegolten hat. Ich sage mir jetzt: „Verloren ist verloren. Entdecke das Neue!“ Die 12 heiligen Nächte entdecken! Zum Schluss noch ein Zitat von Jörg Zink: „Die Zeit um Weihnachten war seit alters von Nächten bestimmt, und alles Große und Wichtige geschah in der Nacht. Das war immer so.“ (S. 9)
Wer mehr zu den heiligen 12 Nächten erfahren möchte, kann mich unter ewaldfoerschler@posteo.de kontaktieren
Auch zu hören auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
26.12.24
Weihnachten kann Frieden schaffen. Davon waren die Fachleute einer Internationen Werbeagentur überzeugt. Sie arbeiteten im Auftrag der kolumbianischen Regierung. Und machten die Sehnsucht vieler Menschen nach einem friedlichen und gemeinsam gefeierten Weihnachten zu ihrer Mission. Um die bewaffneten Kämpfer im kolumbianischen Dschungel dazu zu bringen, die Waffen niederzulegen, riefen die Werbefachleute die „Operation Christmas“, die Kampagne „Rivers of Light“ und die „Operation Bethlehem“ ins Leben. Auf ungewöhnlichen Wegen sandten die Werber in der Adventszeit über mehrere Jahre Botschaften an die bewaffneten Männer und Frauen im Dschungel, die sie überzeugen sollten: „Kommt nach Hause! Legt noch vor Weihnachten die Waffen nieder!“ So werden im ersten Jahr über 20 Meter große Bäume mit unzähligen Lichtern geschmückt – direkt an den Pfaden, die von den Rebellen genutzt wurden. Banner trugen die Aufschrift: „Wenn Weihnachten in den Dschungel kommen kann, kannst du auch nach Hause kommen!“ Über 300 Rebellen sollen diesem Aufruf gefolgt sein und den Dschungel verlassen haben. In einem anderen Jahr wurden über 6000 Christbaumkugeln in den Fluss gesetzt, darin handgeschriebene Botschaften sowie persönliche Geschenke von Familien und Freunden, und vom Wasser direkt in Richtung der Rebellen-Camps getragen. Dann gab es noch diesen starken Lichtstrahl, der bis weit in den Himmel reichte, leuchtend hell aus verschiedenen Dörfern, aus Macarena, aus El Paujil, aus Toribio. Wer den Dschungel bisher nicht verlassen hatte, weil er den Weg nicht wusste, der konnte sich jetzt aufmachen. Er musste nur den Kopf in den Nacken legen und aufs Licht zugehen. Und auch diese Aktion hatte einen Leitspruch: „Weihnachten ist alles möglich.“ Die Botschaft kam an. Wenige Jahre später erhielt der Präsident Kolumbiens, Juan Manuel Santos, den Friedensnobelpreis – für seine ungewöhnlichen und erfolgreichen Wege, die Waffen zum Schweigen zu bringen.
aus: der 30. Andere Adventskalender
Auch auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
25.12.24
Gott, wie er sich in der jüdisch-christlichen Tradition offenbart hat und an ihn geglaubt wird, ist die Liebe. Das ist sein Wesen. Wichtig aber ist, dass diese Liebe nicht für sich bleibt, sondern sich beziehen will auf das, was sie liebevoll geschaffen hat. Der liebende Gott, der sich auf die Menschen einlässt, kommt selbst aus einer in Liebe bewährten Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die Zuwendungslust ist also schon in transzendenter Sphäre (in der Bildsprache „Himmel“) von Ewigkeit zu Ewigkeit her vollzogen, bewährt und gelungen. Hier schon hat Gott in sich gezeigt, dass Liebe sich vollzieht in Beziehung zu den anderen. Liebe ist nie für sich. In dieser trinitarischen Liebe lässt jeder den anderen groß werden und aufblühen. Da gibt es keine Machtkämpfe, keinen Neid, keine Rivalität, kein Beleidigt sein. Den irdischen Gegenbeweis hat die Dreierkoalition von SPD-Grünen-FDP in den letzten drei Jahren abgeliefert. Von der höheren Warte aus betrachtet, hätte das ein Meisterstück gelungener Beziehung werden können. Doch die Unfähigkeit, dem anderen was zu gönnen und ihn zu dem kommen lassen, was ihm unbedingt wichtig ist, ist an Eitelkeit, Rechthaberei und Geltungssucht gescheitert. Aus einer intakten und gelingenden Dreierbeziehung jenseits aller irdischen Wirrungen hat sich dann EINER aufgemacht, um das hohe Risiko einer irdischen Existenz anzunehmen. Jesus lebte den göttlichen Beziehungsfrieden von der Krippe bis zum Kreuz. Man kann also ruhig mal den Kopf schütteln über so viel Unfähigkeit zu gelingender Beziehungsarbeit wie es die verblichene Regierung leider vormachte, weil man sich als Christ aufgehoben weiß im göttlichen Beziehungsnetz. Wenn Gott also die Liebe ist, dann hat es ihn geschmerzt, dass einer gegangen ist. Es war seine Entscheidung, die von den anderen mitgetragen wurde. So drücken es die Worte des Bibelwortes für heute aus: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ (Johannes 1,14a; heutiger Lehrtext)
In gelingender Beziehung leben heißt sich entlasten, von sich absehen und dem anderen gönnen, was ihm wichtig ist – ja noch mehr: ihn fördern und sich daran freuen, wenn er in dem aufblüht, was ihn ausmacht. Geschenkt!
„Hirten, die Letzten“ – heute auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm zu hören
24.12.24
Nicht auszudenken, wenn die Hirten fehlen würden in der Heiligen Nacht! Weihnachten ohne Hirten? Unvorstellbar. Dabei waren sie, vorsichtig gesagt, schon etwas „gewöhnungsbedürftig“. Es war nicht nur der penetrante Geruch, der von ihnen ausging, sondern auch der großzügige „Verzicht“ auf den Beistand des Himmels. Denn Wölfe in die Flucht schlagen oder Diebe verjagen, dazu bedurfte es nicht so sehr der Bibelkenntnisse oder eines großen Gebetsschatzes als vielmehr eines kräftigen Schlages mit dem Knüppel. Die „Frommen“ hätten sich das Fehlen der Hirten in der Heiligen Nacht allemal gut vorstellen können, trugen diese doch nicht unbedingt zum Image des Himmels bei. Weshalb aber der Himmel nicht auf diese windigen Gestalten verzichten konnte, darüber kann man nur Vermutungen anstellen. Die eine Vermutung ist: Gott hat eine Schwäche für die Zukurzgekommenen, für die „Letzten“. Eine andere Vermutung ist: Die Hirten, die Alltagsmenschen, sind eine Gewähr dafür, dass es in der Heiligen Nacht um die „Welt“ geht, dass sich die Erde nicht zu schnell in lauter Himmel auflöst. Anders gesagt: Auch in der Heiligen Nacht bleiben Schafe Schafe und Wölfe Wölfe. Die Hirten mischen dem himmlischen Lobgesang ein paar dunkle, raue Töne bei, so dass die Höhe auch etwas Tiefe erhält.
Die Hirten, also die Letzten, sind die Ersten, die von der göttlichen Botschaft hören, die sich sofort auf den Weg machen, um die Geschichte zu sehen, die da geschehen ist. Und die danach genauso entschieden zu ihren Schafen und Hunden, in ihren Alltag zurückkehren. Das Leben geht wieder seinen Gang, die Geschichte nimmt wieder ihren gewohnten Lauf. Und kaum ist der Himmel geschlossen, sind auch die Gewalttäter sofort am Zuge. Der Geburt des Kindes, das die Welt retten soll, folgt alsbald der von höchster Stelle befohlene Kindermord. Und kein Engel ist zu sehen, der dem mörderischen Treiben Einhalt gebietet. Alles geht seinen gewohnten Gang…
Fortsetzung auf https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm am 25.12.2024
23.12.24
Das irritiert! Einen Tag vor dem Heiligen Abend diese Losung: „Ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir.“ (Psalm 51,5) Es ist, als ob einer einem einen Eimer eiskalten Wasser unvermittelt über den Kopf schüttet. Muss das sein! Kurz vor Weihnachten mit Sünde, Buße, Reue konfrontiert zu werden? Kann nicht mal alles einfach ruhen? Nach Weihnachten kann das Schwere ja wieder einen Platz bekommen. Dieser Wunsch nach einem unbelasteten Weihnachten ist mehr als verständlich. Ich habe ihn auch. Aber eben – es gibt kein Weihnachtsfest ohne das „hartnäckige Da“ (Hannah Arendt) der Schuld, der gegenseitigen Verletzungen und schlimmen Verwerfungen. Soll man das wegwischen, nur weil man an Weihnachten das Stimmungsknöpfchen drücken will? Das könnte böse ausgehen. Daher kommt dieser grundehrliche Satz aus dem Psalm 51 gerade noch rechtzeitig. Am letzten Tag der Adventszeit könnte man noch was in Ordnung bringen, nicht alles, aber das Vordringlichste. Zumindest versuchen könnte man es, weil das Leben eben oft genug aus Anfängen besteht und man recht selten an das Ziel kommt, das man geplant hat. Wenn das Kind in der Krippe kommt und empfangen sein will, dann sucht es seinen Platz in einem Herz, das nicht völlig ausgefüllt ist mit Unerledigtem. Wenigstens ein Winkel im Herzen sollte frei sein, damit es im ganzen Herzen als Licht strahlen kann.
Cautio criminalis von Friedrich Spee=Behutsamkeit bei der Rechtsprechung Teil 2 heute auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
22.12.24
Das Magnificat der jungen schwangeren Maria ist Grundlage der Predigt am heutigen 4. Advent. Es entstand aus der Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth, die ebenfalls schwanger war. Dorothee Sölle meinte, Gott ist das, was zwischen Menschen geschieht. Es lohnt also, am heutigen Adventssonntag dem und im Speziellen der Begegnung von Maria und Elisabeth nachzuspüren. Dazu meine Predigt auf dieser Homepage unter „Tagebuch“.
Cautio criminalis von Friedrich Spee=Behutsamkeit bei der Rechtsprechung Teil 1 heute auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
21.12.24
Gott ist, was zwischen Menschen geschieht, meint Dorothee Sölle. Martin Buber spricht von Gott als dem DU, das uns gegenüber ist. Gott im jüdisch-christlichen Kontext ist also immer systemisch zu verstehen. Der Gegenbegriff zu Gott wäre demnach Einsamkeit, Verlassenheit, Abbruch aller Beziehungen. Gott selbst offenbart sich als der, der Beziehung will. Er tut das an Orten, die kein Mensch aussuchen würde. Die Begegnung mit Mose geschah aus einem Dornbusch heraus (Ex 3,14), wo nicht einmal Vögel ein Nest bauen würden. Die Bibel könnte man auch als „Buch der Begegnungsgeschichten“ bezeichnen. Eine zutiefst bewegende ist die zwischen Maria und Elisabeth (Lk 1,43-44; heutiger Lehrtext). Die schwangere Maria, sie war 14 Jahre alt, machte sich auf den Weg zu ihrer ebenfalls schwangeren Verwandten Elisabeth. Sie musste durch das Gebirge, vier Tage lang. Sie traute es sich zu, diesen Weg ohne Begleitung eines Mannes zu gehen. Als sie Elisabeth traf, hüpfte deren Kind in ihrem Schoß. So kam sie in Berührung mit dem Neuen, das in ihr heranwächst, ausgelöst durch die Begegnung mit Maria. Und sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Diese Szene ist Urbild jeder tiefen menschlichen Begegnung : im anderen das Geheimnis Christi entdecken (so meinte es Dorothee Sölle). Dafür braucht es das, was Maria tat: sich auf den Weg zum anderen machen und über das Gebirge gehen, also die Berge von Hemmungen und Vorurteilen überwinden. Der Lobpreis der Maria (=Magnificat) kündigt an, was im Volk Israel wirklich wird, wenn ihr Kind Jesus geboren sein wird: die Entrechteten werden durch IHN in ihrer Würde wieder hergestellt, die Mächtigen werden vom Thron gestürzt und die Armen groß gemacht. In diesem Befreiungslied der Maria kommt zum Ausdruck, dass Gott alle unsere Maßstäbe über den Haufen wirft und gerade das Niedrige erhöht und den Hunger sättigen will – in der Welt und in uns.
Biographische Notizen zu Friedrich Spee, dem Verfasser von „O, Heiland, reiß die Himmel auf…“ – heute auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
20.12.24
Der Unterschied zwischen Vertröstung und Trost wird aus der heutigen Losung ersichtlich: „Israel aber wird errettet durch den Herrn mit einer ewigen Rettung, und ihr werdet nicht zuschanden noch zu Spott immer und ewiglich.“ (Jesaja 45,17) Worte haben immer einen Kontext, in dem sie entstehen und gesprochen werden. So auch dieses Wort. Es steht im sog. Trostbuch Israels, dem zweiten Jesaja (Kapitel 40-55). Es beginnt mit den Worten: „Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist…“ (40,1) Der historische Kontext ist das Exil in Babylon. Die von den Babyloniern nach der Zerstörung Jerusalems 587 v.Chr. Deportierten wurden in Lager untergebracht, wo sie, ihrer Heimat entrissen, auf eine ungewisse Zukunft zu lebten. Wer so im Elend gefangen ist, braucht alles andere als große Versprechungen und schon gar nicht das Blaue vom Himmel. Er braucht einen Raum, in dem er sich geborgen, aufgehoben sprich: getröstet weiß. Der unbekannte Prophet, der in den Lagern seine Botschaft verbreitete, wird auch der leidende Knecht Gottes genannt (von ihm gibt es im 2. Jesaja 4 Lieder). Für ihn war klar, dass das Exil eine Folge des Ungehorsams gegen Gott war. Doch er verbreitete die frohe Botschaft, dass die Folgen des Fehlverhaltens abgegolten sind. Es soll etwas Neues beginnen, das in Gottes Herzen zu Hause ist und seiner Gnade entspringt. Wenn das jemand so sieht – auch heute – dann darf man das nicht bestreiten oder beurteilen, zumal wenn er selbst in diese Geschichte eingebunden ist. In Babylon hatten sich die Exilierten mit einer fremden Kultur und Religion auseinanderzusetzen. Der unbekannte Prophet aber findet den Trost für die Elenden aus der Glaubensgeschichte seines Volkes. Gott ist der Herr der Geschichte. Reiche und die Reiche dieser Welt liegen in seiner Hand. Die Israel binden, wird er selbst binden und sie seinem Volk vorführen und sie werden den Gott Israels loben und ihm eingestehen: „Nur bei dir ist Gott, und sonst ist kein Gott mehr.“ (45,14) Um dann auch wahrzunehmen, dass dieser Gott kein von menschlicher Phantasie geschaffener, sondern ein „verborgener Gott“ ist (45,15). Gerade weil er das ist, ist IHM nichts unmöglich, weder die immanente Rettung des Volkes durch Kyros (er wird in 45,1 Messias genannt) noch die transzendente. Diese Aussicht weit über die immanente Zukunft hinaus, ist wahrer Trost. Er gilt auch für uns!
Heute auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm Josef, der „andere“ Bruder
Vorschau: vom 21.-23.12.24 gibt es auf meinem Podcast eine Reihe zu Friedrich Spee von Langenfeld, Katholik und Jesuit (Biographie und Einführung in sein Buch „cautio criminalis“, der Gegenschrift zum „Hexenhammer“). Von ihm stammt das Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf…“
19.12.24
Josef, der zweitjüngste Sohn von Jakob und Rahel, war anders. Er war gerne zu Hause bei seiner Mutter. Sein Vater hatte ihm ein kostbares Kleid geschenkt, das seine Brüder neidisch machte. Aber waren sie allein wegen des Kleides neidisch? Vermutlich war es etwas anderes. Ein Junge in einem Frauenkleid. Das ist komisch. Und dann träumt er auch noch wie das eigentlich nur Mädchen machen. Und erzählt die Träume einfach so, nicht um etwas zu erwarten oder beachtet zu werden. Jedenfalls konnte Josef nichts dafür, dass er so war und sich in einem Kleid wohlfühlte. Die älteren 10 Brüder – es waren die Kinder von Jakob und Lea – waren auf dem Feld und gingen ihrem Beruf als Hirten nach. Jakob schickte Josef mit Proviant für sie los. Josef sollte sie fragen, wie es ihnen geht (Gen 37,14; Losung heute). Ahnungslos machte er sich auf den Weg. Doch die Brüder zu finden war nicht einfach. Ein Fremder sprach Josef an, weil er sah, wie dieser auf dem Feld umherirrte. Er konnte Josef Auskunft geben: „Deine Brüder sind weggegangen. Ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns nach Dotan gehen.“ (Gen 37,17 heutige Losung; Dotan war eine antike Stadt in Mittelpalästina, 100 Kilometer nördlich von Jerusalem und etwa 20 Kilometer nördlich von Sichem, dem benachbarten Samaria im Gebiet des Stammes Manasse. In der Dotan-Ebene lag eine wichtige Karawanenstraße von Syrien nach Ägypten) Josef fand den Weg. Als seine Brüder ihn kommen sahen, planten sie, ihn zu töten. Doch Ruben, der älteste von ihnen, überzeugte sie mit dem Plan, Josef in einen Brunnen zu werfen und sein Kleid mit dem Blut eines Tieres zu tränken und dem Vater zu erzählen, Josef sei von einem Tier getötet worden. So machten sie es schließlich. Sie warfen ihren Bruder in eine Grube. Als eine Karawane der Ismaeliter vorbeikam, verkauften sie ihn an diese. So landete Josef schließlich auf dem Sklavenmarkt in Ägypten.
Eiskalt und ohne Mitgefühl fügen die 10 älteren Brüder ihrem „anderen“ Bruder übelstes Leid zu. Sie schänden ihn, sie ziehen ihn aus, sie werfen ihn in eine Grube ohne Wasser und verkaufen ihn, als wäre er eine Ware. Das wirft die Frage auf: Was bricht sich Bahn, wenn Menschen einem anderen ein solches Leid zufügen? Die Geschichte des Josef konfrontiert uns mit dem in uns, was es nicht ertragen kann, dass jemand des gleichen Geschlechts anders ist.
Morgen ab 05:00 Uhr auch auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
Vorschau: vom 20.-23.12.24 gibt es auf dem Podcast eine Reihe zu dem Adventslied „O, Heiland, reiß die Himmel“ und dessen Verfasser Friedrich Spee von Langenfeld, Katholik und Jesuit
18.12.24
Was soll man von Abram anderes sagen, als dass er seinem Gott vollkommen ergeben war? Oder gar hörig? Er gilt als Vorbild des Glaubens. Gott sagt und Abram macht. „Steh auf und geh!“ Abram macht es, ohne zu fragen und zu zweifeln. Gott sagt: „Opfere mir deinen Sohn Isaak!“ Abraham richtet alles her, lügt seine Frau Sarai und seinen Sohn an, dass sich die Balken biegen, nur um zu tun, was sein Gott ihm befiehlt. Sein Gott, der ihn einfach nur testen will. Sieht so Glaube im Vollzug aus? Und ist es immer so klar, was Gott will? Abram, später Abraham, war am Anfang ein „umherirrender Aramäer“. Erst durch den Bund mit Jahwe wurde er zu einem Juden. Er hieß Abram den nächtlichen Sternenhimmel wahrnehmen und so erkennen, dass seine Nachkommen nicht an zwei Händen abzuzählen sein werden.
Abram wird für mich durch den Weg, den er von sich aus geht, ein Vorbild. Insofern, als er auch die Wege geht, die er nicht versteht und die man am liebsten gar nicht haben möchte. Abraham ist für mich der Urtyp von Mensch, dem es gut geht und der zufrieden ist mit sich, seiner Familie und seinem Leben. Eines Tages aber fährt aus heiterem Himmel der Gedanke in sein Gemüt: „Ist es das für den Rest meines Lebens?“ Er hat sich diesem Impuls gestellt und ist losgegangen. Unterwegs dann erfährt er Gottes Schutz und dass es sich lohnt, mit diesem Gott unterwegs zu sein (Genesis 15,1; heutige Losung). Glaube nach Abraham hat also eine skeptische Haltung gegenüber allem Haben und Festhalten wollen. Die „Sesshaftigkeit“ der Kirchen verträgt sich so gar nicht mit dem Aufbruchswille Abrahams. Sich von ein paar Pfarrhäusern, Kirchen oder Gemeindehäusern trennen, ist nicht annähernd abrahamlike. Das wäre es, wenn man ohne zu klagen und zu jammern seine sieben Sachen packen und losziehen würde ins versprochene Land. Mit Glauben ins Ungewisse. Kirche wäre dann nicht nur mobil, sondern auch leicht, flexibel und nahe bei den Menschen. Um nicht zu sagen – unter oder gar ein Teil von ihnen. Sie wäre sich dessen bewusst, dass „Sesshaftigkeit“ nur vorübergehend ist. Kirche als spirituelle Gemeinschaft ist eh fremd in den Gemeinschaften dieser Welt (Helmut Gollwitzer).
Morgen ab 05:00 Uhr auch auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
17.12.24
Verheerende Zustände, wie man sie heute aus korrupten Staaten und Militärdiktaturen kennt, werden in Psalm 94 vom Volk Israel berichtet: es herrschen Rechtswillkür und Rechtsverwilderung. Mächtige üben gegen Wehrlose, Reiche gegen Arme Terror aus, indem sie zynisch das Recht manipulieren und Recht zur Durchsetzung von Unrecht missbrauchen. Hochfahrende (V2), Frevler (V3.13), Übeltäter (V4.16), Bösgewillte (16) scheiden sich der Jurisdiktion bemächtigt zu haben und schrecken vor nichts zurück. Nicht einmal vor Justizmorden, wie es in den Versen 6 und 21 erzählt wird („Sie töten die Waisen“ – „Sie verurteilen unschuldiges Blut“), sie wüten wie Bestien (V8) gegen die Schwächsten und Schutzlosesten im Volk, gegen Witwen, Fremdlinge und Waisen (V6), ebenfalls gegen die „Zaddikim“, die Bewährten, die Gottes Gegenwart und Weisung noch wie vor ernst nehmen (V21). Die Übeltäter dagegen prahlen spöttisch: „Gott sieht es nicht, er merkt es nicht!“ (V7) Dem stellt der Psalmist, der selber von diesem Terror betroffen ist, Fragen gegenüber, die Gottes (All-)Macht bezeugen sollen (Vv8-11). Das Recht in Israel war stets an Gott gebunden. Ohne ihn war es nicht zu haben und nicht zu handhaben. Doch gerade dies schien in Israel auseinandergefallen zu sein. Löst sich das Recht und die Rechtsprechung von ihrem göttlichen Band, werden sie von den Mächtigen zu ihren eigenen Gunsten manipuliert. Das Recht Gottes jedoch gilt insbesondere den Machtlosen, Benachteiligten und Armen. Vorrang haben in ihm die Rechte der Witwen, Waisen und Fremdlinge. Wer diese beugt und verletzt, zertritt das Volk als Gottes Eigentum (V5). Also! Jede Form von Klassenjustiz ist gottlos. Und welche Justiz welchen Landes wäre frei von der Gefahr, wenn nicht auf grobe, so doch auf subtile Weise zur Klassenjustiz zu werden? Gott will ein Recht, das solidarisches Verhalten unter den Menschen ermöglicht, schützt und fördert. Es muss zurück in die Hände der Menschen mit rechtschaffenem Sinn! (V15; Losung von heute).
Am Ende des Psalms wird eine erstaunliche Wendung beschrieben. Was die Übeltäter getan haben, soll ihnen eins zu eins selbst widerfahren (immanente Nemesis=Zuteilung des Gebührenden zu Lebzeiten). Das beugt der Rache vor, auch der Rache Gottes. Denn Gott bindet sich an sein eigenes Recht. Ihn als „Gott der Rache bzw. Vergeltung“ (V1) zu sehen, wäre demnach falsch. Richtig ist es, ihn mit „Gott der Ahndungen“ (Martin Buber) zu sehen. „Ahnden“ bezeichnet ein Rechtshandeln. „Rache“ ist dagegen ein Handeln außerhalb der Rechtsordnung.
Der Psalm 94 ist also richtungsweisend für uns Heutige. Er schärft uns den Blick für das subtile Unrecht, das es auch in einer Demokratie gibt.
Morgen ab 05:00 Uhr auch auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
16.12.24
In ihrem Buch „Leiden“ differenziert Dorothee Sölle diesen Begriff auf eine Weise, die mir einleuchtet. Leiden ist so was Großes, gar Übermächtiges, dass man versuchen muss, es zu benennen bzw. zu ordnen. Nach Sölle kann man von „Leiden“ sprechen, wenn es sich in drei Dimensionen äußert: in der physischen, psychischen und sozialen. Natürlich sagt man, wenn man Schmerzen hat, man verlassen wurde oder in einer Depression festhängt: „Ich leide wie ein Hund!“ Sölle würde das aber nicht „Leiden“ nennen, weil sich darin nur eine der drei Dimensionen zeigt. Statt von „Leiden“ spricht sie von Schmerzen, Unglück oder „Wehwehchen“. Ich habe mir das Leiden Jesu angeschaut und dazu die Berichte aus dem Matthäusevangelium gelesen. Als ich fertig war, staunte ich nicht schlecht: bei Jesus sind alle drei Dimensionen geradezu „überfüllt“. Er wird körperlich misshandelt. Er wird verspottet und öffentlich verhöhnt. Er wird von allen verlassen. Was bei ihm noch dazu kommt, taucht bei Sölle nicht auf. Er musste auch erleben, dass sein Gott ihn verlassen hat. Also muss man zu den drei Dimensionen von Sölle noch eine vierte hinzunehmen: die spirituelle. Ein Leiden in diesen vier Dimensionen wie bei Jesus ist nicht zu überbieten. Man kann also mit Recht von der „Leidensgeschichte Jesu“ sprechen. Vor der kompletten Isolation am Kreuz bat Jesus seinen Gott: „Mein Vater, ist´s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst.“ (Mt 26,39; Lehrtext heute) Das flehte er mit dem Gesicht zum Boden. Äußerlich schon eine Geste der Ergebung, in der er seine letzte Bitte äußert. Der Leidenskelch ging nicht an ihm vorüber. Er hat ihn bis zum letzten Tropfen geleert. Sage aber niemand, dass das Gottes Wille war. „Nicht wie ich will, sondern wie du willst!“ – heißt nicht, denen die Macht zu überlassen, die mit allen Abwassern dieser Welt gewachsen sind oder ihre Hände in Unschuld waschen, was sowieso nicht geht. „Wie du willst!“ ist der (aller)letzte Versuch, sich der Geborgenheit in Gottes Liebe zu vergewissern. Dem entspricht der letzte Satz, den Jesus am Kreuz sprach: „In deine Hände befehle ich meinen Geist!“.
Dietrich Bonhoeffer hat gezeigt, dass sich Ergebung und Widerstand nicht widersprechen müssen. Sich in Gottes Willen hineinbegeben heißt nicht, sich dem Willen von willfährigen Menschen auszusetzen. Im Gegenteil!
Morgen ab 05:00 Uhr auch auf meinem Podcast https://tief-glauben-weit-denken.letscast.fm
15.12.24
Am 3. Adventssonntag überrascht und bereichert ein Abschnitt aus dem Römerbrief im 15. Kapitel. Ein Textabschnitt der Reihe I, der erstmalig Grundlage einer Predigt ist. Ich bin heute in der Melanchthongemeinde in Freiburg. Das Thema meiner Predigt zu Römer 15 lautet: „Was ich noch zu sagen hätte…“ (siehe auch unter „Predigten“ auf dieser Homepage). Ich wünsche dir einen besinnlichen 3. Advent 2024!
14.12.24
Ob das so eine gute Idee war, David zum König zu salben? Samuel hatte Saul zum ersten König Israels gesalbt. Als er gegen einen Befehl Gottes verstieß, ließ der ihn fallen und Samuel salbte heimlich David zum König und machte ihn so zum Rivalen von Saul. David (hebr.) heißt auf Deutsch „der Geliebte“. Das war er – ein Liebling Gottes und einer, dem fast alles gelang. Doch ihm fehlte die Gabe, andere Menschen zu lieben. Deshalb konnte er mit kaltem Herzen auf dem Schlachtfeld Erfolge zeitigen und sich eine Frau nehmen, die verheiratet war. Als sie von ihm schwanger wurde, versuchte er die Schwangerschaft ihrem Ehemann unterjubeln, indem er ihm Fronturlaub gewährte. Aber Uria schlief nicht mit seiner Frau Bathseba. Nachdem dieser Plan gescheitert war, befahl er, Uria an der Front zu stationieren. Den Einsatz überlebte er nicht. Bathseba wurde Witwe durch den kalkulierten Mord des Mannes, der sie geschwängert hat – David, den König. Er nahm sie an seinen Hof. Sie wurde eine von vielen Frauen. Sie brachte einen Sohn zur Welt. Er hieß Salomo. Von ihm heißt es, dass Gott ihn liebte (2. Samuel 12,24). Doch anders als heutige Mächtige und Autokraten kam David nicht so einfach davon. Was man von den einen hofft, dass sie im endzeitlichen Gericht die Leviten verlesen bekommen, so wurde dieser von Nathan, dem Nachfolger Samuels, hart rangenommen. Er konfrontierte ihn mit seiner vielschichtigen Tat. Denn sie bestand nicht nur aus dem Ehebruch, sondern auch den Versuchen, diesen ungeschehen zu machen. Deshalb klagte Nathan David an. „Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel?“ (2. Samuel 12,9; heutige Losung). Erst als Nathan David die schwerwiegenden Folgen seines Tuns aufzeigte, gestand ihm David: „Ich habe gesündigt gegen den Herrn.“ (2. Samuel 12,13)
Mich schaudert bei dieser Geschichte, weil ich sehe, wie Mächtige ihre Macht missbrauchen und es auch noch schaffen, sie zu vertuschen. Dann tröstet mich diese Geschichte auch, weil ich sehe, dass es in Nathan einen Mann der Wahrheit gibt. Das zeigt mir: über kurz oder lang kommt keiner einfach so davon!
13.12.24
1950 wurde Gollwitzer als Nachfolger von Karl Barth ordentlicher Professor für Systematische Theologe in Bonn, wo er bis 1957 lehrte. 1951 heiratete er die evangelische Theologin und Gemeindereferentin Brigitte Freudenberg (1922-1986), eine Tochter von Adolf Freudenberg. Die beiden bekamen keine Kinder.
In den 1950er Jahren engagierte er sich stark gegen die deutsche Wiederaufrüstung, vor allem gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr im Rahmen der NATO. Mit seinem Vortrag „Die Christen und die Atomwaffen“ vom Juni 1957 reagierte er auf den „Göttinger Appell“ der Physiker um Carl Friedrich von Weizsäcker und löste eine nachhaltige ethische Debatte in der Evangelischen Kirche Deutschland aus, die sich bis weit in die katholische Kirche und Ökumene hinein fortsetzte. Unter konsequenter Anwendung der kirchlichen und völkerrechtlichen Kriterien für einen gerechten Krieg kam er zur kompromisslosen Verwerfung aller Massenvernichtungsmittel.
Die Debatte drohte die evangelische Kirche zu spalten. In der Folge wurde Gollwitzer in eine Kommission berufen, die 1959 mit den „Heidelberger Thesen“ einen Kompromiss erarbeitete. Die Kirche muss sowohl „den Waffenverzicht als eine christliche Handlungsweise anerkennen“ als „auch die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit zu sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen“. Dies führte entgegen Gollwitzers Absicht nicht zur Überwindung, sondern zur Rechtfertigung des militärischen Abschreckungskonzepts der NATO.
Seit 1957 lehrte Gollwitzer an der Freien Universität Berlin im neu gegründeten Institut für Evangelische Theologie. 1961 sollte er Karl Barths Lehrstuhl an der Basler Universität übernehmen, doch die Basler Behörden legten dagegen wegen seiner „unklaren“ Einstellung zum Kommunismus ein Veto ein. So blieb Gollwitzer bis zu seiner Emeritierung 1975 in Berlin, wo er zeitweise auch an der Kirchlichen Hochschule lehrte. Er nahm von Anfang an regen Anteil an den Anliegen der kritischen Studenten, die er als einer von ganz wenigen Hochschullehrern aktiv unterstützte. Er engagierte sich für die 68er-Studentenbewegung, war befreundet mit Rudi Dutschke und Seelsorger von Ulrike Meinhof, setzte sich auch als Mitglied der Internationale der Kriegsdienstgegner gegen Vietnamkrieg und Wettrüsten ein. Obwohl von studentischen Kreisen gern als Vertreter des Establishments apostrophiert, wurde er als engagierter Dialogpartner hoch geschätzt. Eine langjährige und enge Freundschaft bestand mit Gustav Heinemann. Ab März 1979 war er Juror des Dritten Russell-Tribunals in Frankfurt-Harheim, das Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland anprangerte. 1980 wurde er ehrenamtlicher Bewährungshelfer für den aus der Haft entlassenen Horst Mahler.
Er wurde neben seiner Frau auf dem evangelischen St. Annen-Kirchhof in Berlin-Dahlem bestattet. Die Beerdigungsansprache hielt sein langjähriger Freund Friedrich-Wilhelm Marquardt.
Jesus trat zu den Jüngern, rührte sie an und sprach: „Steht auf und fürchtet euch nicht!“ Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. (Mt 17,7.8)
12.12.24
Helmut Gollwitzer (1908-1993) war evangelischer Theologe, Schriftsteller und Sozialist. Als prominenter Schüler von Karl Barth engagierte er sich in der Bekennenden Kirche der NS-Zeit, später in der „Kampf-dem-Atomtod“-Bewegung der 1950er Jahre und der Studentenbewegung der 1960er-Jahre. Als Professor an der Freien Universität Berlin war er ein enger Freund von Rudi Dutschke.
Gollwitzer stammte aus einem lutherischen und national-konservativen fränkischen Elternhaus. Er war als Schüler am Gymnasium bei St. Anna in Augsburg in der Jugendbewegung der 1920er Jahre aktiv und studierte von 1928 bis 1932 Philosophie in München und Evangelische Theologe, u.a. bei Paul Althaus in Erlangen und Friedrich Gogarten in Jena. Karl Barth in Bonn wurde sein wichtigster Lehrer, der seine eigene Haltung zeitlebens prägte.
Von 1933 an war Gollwitzer scharfer Kritiker der „Deutschen Christen“ und seit 1934 Mitglied der „Bekennenden Kirche“. Er gehörte dort zu den „Dahlemiten“, die wegen der Barmer Theologischen Erklärung vom 31. Mai 1934 nicht nur die staatlichen Übergriffe auf die evangelische Kirche, sondern auch die Rassenpolitik der Nationalsozialisten ablehnten. Er stand auch dem Antijudaismus innerhalb der „Bekennenden Kirche“ kritisch gegenüber.
Nachdem Karl Barth den Beamteneid auf Adolf Hitler verweigert hatte und deshalb Deutschland verlassen musste, folgte Gollwitzer ihm in die Schweiz und promovierte 1937 in Basel.
Nachdem Martin Niemöller, einer der Leiter der „Bekennenden Kirche“, im Juli 1937 inhaftiert worden war, übernahm Gollwitzer Prediger- und Pfarrdienste an dessen Pfarrstelle, der Sankt-Annen-Kirche in Berlin-Dahlem. Der Gemeinderat hielt Niemöllers Stelle jedoch frei, so dass Gollwitzer nicht dessen offizieller Nachfolger oder Vertreter wurde. Zudem half er bei der illegalen Ausbildung des theologischen Nachwuchses der „Bekennenden Kirche“. Seit den Novemberpogromen 1938 verhalf er vom NS-Regime verfolgten Juden zur Flucht bzw. Ausreise.
Seine Kontakte zu Widerständlern in der Wehrmacht brachten ihm 1940 mehrere Verhaftungen und Redeverbot ein. Seit diesem Jahr war er verlobt mit Eva Bildt, der Tochter des bekannten Schauspieler Paul Bildt. Wegen deren jüdischen Mutter erhielt er jedoch von den Nazis ein Heiratsverbot. Eva Bildt nahm sich am 27. April 1945 das Leben, nachdem ihr Zufluchtsort Zeesen durch die Rote Armee besetzt worden war und sie dort Zeugin von Vergewaltigungen geworden war.
Im Zweiten Weltkrieg war Gollwitzer als Sanitäter an der Ostfront eingesetzt. 1945 geriet er in sowjetische Gefangenschaft und kam in ein Arbeits- und Umerziehungslager. Erst dort erfuhr er vom Suizid seiner Verlobten. Nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion Ende 1949 schrieb er ein Buch über seine dortigen Erlebnisse, in dem er sich intensiv mit dem Marxismus-Leninismus sowjetischer Prägung auseinandersetzte:…und führen wohin du nicht willst. Dieser authentische Bericht erschien 1951, wurde rasch zu einem Bestseller und in mehrere Sprachen übersetzt. Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss beschrieb es als „großes geschichtliches Dokument“.
Fortsetzung morgen…
11.12.14
„Seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf dass, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun.“ (Lehrtext aus dem Lukasevangelium 12,36). In seiner Auslegung des Lukasevangeliums betitelt Helmut Gollwitzer (1908-1993) den Abschnitt, in dem dieser Satz Jesu steht, mit der Frage „Wofür lebt der Mensch?“ Antwort: „Die Freiheit wovon ist eine Freiheit wozu. Damit er frei sei, in sie hinein aufzubrechen, wird der Jünger von den gegenwärtigen Sorgen, die ihn binden könnten, befreit.“ Der Jünger Jesu in dieser Welt der Geschäftigkeit (Hartmut Rosa spricht vom „rasenden Stillstand“) lebt in einer Art „Zwischenzeit“. Er sieht sein Leben nicht darin, sich alles Mögliche zu leisten und Wünsche zu erfüllen. Sein Markenzeichen in dieser Zwischenzeit ist das Warten. Er hat ein anderes Verständnis von Zeit als einer nur vergehenden und endenden Kategorie. Der Jünger ist in der Dynamik Jesu als dem Gekommenen und dem Kommenden verortet. In dieser Zeitspanne und Zeitspannung lebt er. Das macht ihn zu einem anderen, zu einem „Unterschiedsmenschen“. Seine zwischenzeitliche Existenz ist denen, die in dieser Zeit gefangen sind, fremd und unangenehm. Sie wollen es klar haben. Sie wollen wissen, was und wer wann genau kommt. Sie wollen Planungssicherheit. Dem Jünger (und in diesem Sinn auch die Jüngerin) reicht die Gewissheit, dass Jesus kommen wird. Seinem Warten entspricht das Wachsein. Nur der Wache kann bereit sein, dem „Bräutigam“ die Tür zu öffnen, wenn er vom Fest kommt. Das ist mal ein Gedanke, den wir behalten sollten: seit geraumer Zeit ist Jesus am Feiern. Er feiert den göttlichen Reichtum im Überfluss. Er hat allen Grund zu feiern. Schließlich hat er dem Tod die Macht genommen. Und eines Tages wird er sich vom himmlischen Fest verabschieden und zurückkehren. Und dann sollten sich die, die sich hier seine Jünger nennen (also du und ich und die Kirchen), als Schlafmützen entpuppen und nicht vorbereitet sein? Was ist denn die Kirche anderes als eine globale Wartegemeinschaft! Heimatlos ist sie in den Gemeinschaften dieser Welt. Das lässt sich nicht vermeiden. Also Kirche – Aufgepasst! Nicht schlafmützig werden! Schön wach und anders bleiben!
Es hat mir gutgetan, wieder einmal einer Auslegung zu lauschen, die so kernig und klar mit dem Ernst und der Tiefe der biblischen Botschaft ernst macht. Ich fühle mich von Gollwitzer abgeholt und getröstet. Zeit seines Lebens war er erkennbar in Wort und Tat. Dazu mehr im Tagesimpuls morgen.
10.12.24
„Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.“ Diese Worte des Apostel Paulus stammen aus dem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth (Kapitel 4,6; heutiger Lehrtext). Im darauffolgenden Satz nennt Paulus das Gut, von dem er hier schreibt, einen Schatz. Er selbst hat diesen Schatz in sich als einem zerbrechlichen Gefäß. Und wieder typisch Paulus ist, dass dadurch der Schatz aufleuchtet und nicht das Gefäß, das ihn beherbergt. Paulus verbindet in diesem Satz die Erschaffung des Lichts mit der inneren Erleuchtung in einem Menschen im Bezug auf Jesus Christus . Dabei ist für ihn Gott in beidem der Erschaffer des Lichts: im Anfang der Welt als Grundlage für den Rhythmus von Tag und Nacht und bei den Gläubigen als Erkenntnisfunke bzw. Aha-Erlebnis: Gottes Herrlichkeit spiegelt sich in Jesus Christus wider (Christuserkenntnis als zweite Lichtschöpfung Gottes). Anders als bei Mose, dessen Gesicht das Volk wegen des Glanzes darauf nicht ansehen durfte (3,7 und 2. Mose 34,29ff.) Wie im Anfang das Licht in der Finsternis anging, so ist das Erkennen, dass Jesus Gottes Wirklichkeit verkörpert, dem Anknipsen eines Lichts in einem dunklen Raum vergleichbar. Der dunkle Raum ist die Vernunft. Das Erkennen der Göttlichkeit Jesu (es ist ein ständiges Bemühen, aber letztlich ein Geschenk des Heiligen Geistes) kann man auch Glaube nennen. Der ist Teil von mir als ganzem Menschen. Der Glaube bekennt: „Ja, du bist es!“ Gott in Jesus. Nicht philosophisch und statisch betrachtet, sondern dynamisch. Das ist der Gott, der eine unbändige Zuwendungslust hat und mit und bei den Menschen sein will. Es ist der Gott, der barmherzig ist und verloren geglaubte Rückkehrer mit offenen Armen empfängt. Es ist der Gott, der sein Leben gibt. Es ist der Gott, der Liebe ist und nichts für sich behält. Es ist der Gott, der die Tür zum Leben öffnet. Es ist der Gott, der die Freiheit liebt und die Gerechtigkeit. Es ist der Gott, der es mit den Kleinen hält und die Mächtigen vom Thron stößt (Magnificat)…Ich muss mir hier Einhalt zu gebieten. Mache doch du weiter. Was von Gott erkennst du in Jesus?
09.12.24
Das blöde Gerede von dummen Menschen geht mir unglaublich auf den Senkel! Wie soll man mit Menschen in ein Gespräch finden, die durchdrungen sind von Bosheit, Heuchelei und Mobbinggelüsten? Der ehrliche Impuls wird im Keim erstickt. Was mir passierte macht mich gleichzeitig mit dem Psalmisten. Die Ignoranten um ihn herum lösten bei ihm großes Leid aus. Der einzige Raum, der ihm blieb und in dem es ihm gutging, war das Gebet. Daraus stammt die heutige Losung: „Lass sich freuen alle, die auf dich trauen.“ (Psalm 5,12) Er fordert Gott auf, allen Menschen Freude zu schenken, die ihm vertrauen. Ich fühle mich an das Lied von Cyriakus Schneegass von 1598 erinnert: „In dir ist Freude in allem Leide…“ (EG 398) Der Psalmist beginnt sein Gebet mit einem Schrei (V 2) und bittet Gott, dieses Schreien zu hören. Es schließt sich ein zu Herzen gehendes Flehen darum an, dass sich Gott ihm, diesem leidenden Menschen, zuwenden möge. Dann bricht es aus ihm heraus. Die Gottlosen, die Selbstsüchtigen, die Lügner, seine Feinde machen ihm das Leben schwer, gar unmöglich. Ich spüre ihm ab, wie fertig er ist. Geblieben ist ihm einzig das Ausharren im Trostraum des Gebets. Dort kann er ausschütten, was seine Seele belastet. Ohne Hemmungen spricht er aus, was diese Menschen in ihm für ein Unheil anrichten. Ich ziehe vor diesem Menschen den Hut. Er übergibt alles Gott. ER soll alles machen. Er gibt auch seinen Hass ab, der ihn in die Rache und damit in eine Sackgasse führen würde.
Für alle, die sich in diesem Menschen des Psalm 5 wiedererkennen, wird er zum Vorkläger und Vorbild: „Du bist nicht allein mit deinem Leid. Du kannst dich im Gebet niederlassen und alles sagen. Gott hört dir zu. Du betest zu einem Gott, der die Gerechtigkeit liebt.“ Und so darf sich der Psalmbeter von Gott als Gerechten (V13) gewürdigt sehen und damit mit sich selbst im Reinen sein – mitten in seinem Leiden.
08.12.24
Schonungslos! Kein anderes Wort scheint mir passender zu sein für das, was heute in der Losung steht: „Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben unrecht getan und sind gottlos gewesen.“ (Psalm 106,6) Ich möchte diesen Satz jetzt genau ansehen. Das Schuldbekenntnis des Volkes ist in der Gegenwart verortet. Diesem „Wir“ begegnet man auch in der Stuttgarter Schulderklärung: „Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßt bei seiner Sitzung am 18./19. Oktober 1945 in Stuttgart Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen. Wir sind für diesen Besuch umso dankbarer, als wir uns mit unserem Volk nicht nur in einer großen Gemeinschaft der Leiden wissen, sondern auch in einer Solidarität der Schuld. Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus: Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben…“ Während das kollektive Schuldbekenntnis in die Öffentlichkeit drängt und dort auch hingehört, findet das persönliche Schuldbekenntnis seinen Platz im Gebet und in der Zweierbeziehung, ist also intim. Das „Wir“ ermöglicht den Blick in die Geschichte („unsere Väter“). Es wird erkannt, dass es ein Schuldgeflecht gibt. Doch zwischen der Schuld der Väter und der eigenen wird unterschieden. Die Geschichte im Rückblick und die Geschichte, in der man steckt, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Konkret wird eine zweifache Dimension der Schuld bekannt: das Versagen gegenüber den Mitmenschen und gegenüber Gott. Diese schonungslose Offenheit und Klarheit des Psalm 106 stellt den Kontrast zur Glaubenssicherheit des Psalm 105 dar. Erwählt zu sein ist ein Gottesgeschenk. Daraus darf keine einem Volk innewohnende Superiorität werden. Im fanatischen Delirium hat noch niemand eine Schuld bekannt!
So gesehen passt der Satz zum Advent. Er ist eine Einladung zu einer „schonungslosen Bilanz“ des Bisherigen und des Gegenwärtigen. Also einfach die Chance ergreifen und nicht auf andere zeigen, sondern nur sich selbst sehen. Und dann erleben, wie schmerzhaft und befreiend das sein kann.
07.12.24
Ich nenne es das James-Dean-Drama. In „Jenseits von Eden“ bemühte sich der Sohn mit allem um die Gunst seines Vaters. Aber er konnte es ihm nie recht machen. Immer hatte der Vater etwas an dem auszusetzen, was sein Sohn in bestem Bemühen machte, um einmal zu erleben, dass sein Vater ihn dafür lobt. Doch dazu kam es nie. Nicht umsonst heißt der Film „Jenseits von Eden“. Denn er ist im Grunde eine moderne Verfilmung der urmenschlichen Kain-Abel, Kain-Adam, Mensch-Gott-Dramatik. Sie ist in dem Raum in die Menschheit getreten, der jenseits des Paradieses liegt. Seitdem gibt es dieses Drama, dass Menschen nicht gesehen, betrogen und verkannt werden. Seitdem gibt es auch die dramatischen Reaktionen darauf wie Neid und Mord. Jenseits des Paradieses – darf man der Bibel danken, dass sie sich nicht scheut, das zu erzählen? – überstürzen sich die Ereignisse. Eva hat noch den süßen Geschmack des Paradieses auf der Zunge, als sie schwanger wird und ihr erstes Kind Kain zur Welt bringt. Bald danach kam Abel auf die Welt. Kain wurde Bauer, Abel Schäfer. Das deutet auf ein ausgewogenes, gar intaktes Familienleben hin. Also doch ein Rest von Paradies? Leider nicht! Denn als Gott ins Spiel kam, lief was schief. Kain opferte ihm von seiner Ernte. Abel auch. Das vegetarische Opfer Kains von den Früchten des Feldes missachtete Gott. Das wohlriechende Fleischopfer von Abel nahm er an. Kein Wunder, dass sich Kains Gemüt verfinsterte. Gott meinte es tatsächlich nicht gut mit Kain, denn er unterstellte ihm fehlenden Glauben. Will heißen: wenn er genug Glauben hätte, würde er die Ablehnung seines Opfers klaglos hinnehmen. Das überzeugte Kain nicht und so schlug er zu und tötete seinen Bruder. Dann kam es zu dieser Frage, die ebenfalls zur DNA der Menschheit gehört: Was hast du getan? (1. Mose 4,10) Kain konnte darauf nicht antworten, weil Gott ihm sofort die Konsequenzen seines Mordes aufzeigte. Unruhig und ohne inneren Frieden würde er auf der Erde umherirren. Seine Feldarbeit würde nicht zum Überleben reichen. Kain beschwerte sich. Er war sich im Klaren darüber, dass das sein Todesurteil bedeutete. Da zeigte Gott eine winzige gnädige Regung: er versprach Kain, seine schützende Hand über ihn zu halten.
Wir leben jenseits von Eden. Nichts, was wir planen oder uns ausdenken, kann jemals paradiesische Qualität haben. Ich bin weit davon entfernt zu akzeptieren, dass Gott aus Gunst annimmt und ablehnt, um den Glauben zu testen. Mir gibt diese Geschichte und insbesondere die Rolle Gottes in dieser Geschichte zu denken, um nicht zu sagen – sie macht mir zu schaffen. Und ich gestehe mir ein, dass ich nicht alles verstehen muss…
06.12.24
Was haben Wasser und die Liebe gemeinsam? Beide suchen die tiefste Stelle. Der christliche Glaube kann in einem Satz zusammengefasst werden: Gott ist Liebe. Diese Liebe existiert nicht für sich. Liebe sucht die Beziehung, das Gegenüber. Liebe will sich mitteilen, beim anderen ankommen. Liebe will da sein, wenn´s drauf ankommt. Und es kann sein, dass das gerade ein hartes Stück Arbeit ist an einer Krise, an einer Krankheit, an einem zugefügten Schmerz. Liebe will „sympathisch“ sein. Das Wort stammt aus dem Griechischen. „Sym“ bedeutet „mit“ und „pathein“ bedeutet „leiden“. Die Liebe will ihr Dasein in allen Lebensbereichen verwirklichen. Daher erübrigt es sich zu sagen, dass die Liebe, die Gott ist, nicht annähernd einen Hauch von Romantik hat. Sie stellt sich auch den Situationen, die uns Menschen an den Rand unserer psychischen und physischen Kräfte bringen. Da will sie da sein. Wie ein Mensch, der sich an das Bett eines anderen setzt und ihm die Hand hält. Das reicht. Wie ein Vater, der mit seiner Tochter Hand in Hand geht und man weiß: egal, was passiert – die beiden sind gehalten. In der Zeit in Deutschland, als die Liebe mit hasserfüllten Parolen zusammengeschrien wurde, hat Arno Pötzsch 1941 gedichtet: „Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod doch ein in Gottes Gnade trotz aller unserer Not. Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit.“ Dietrich Bonhoeffer, am 9.4.1945 von den Nazis im KZ Flossenbürg erhängt, glaubte ohne Zweifel, dass er „von guten Mächten geborgen und treu und still umgeben ist“. Die größte und bewegendste Liebe, derer wir uns gewahr werden können, ist die Liebe des Schöpfers zu dem, was er geschaffen hat: die Welt mit ihrer Vielzahl von Leben. Er will mit ihr in Beziehung sein. Gottes Zuwendungslust ist nicht zu bändigen. Bis heute. Bis zu euch, die ihr das gerade lest. Es würde Gott das liebende Herz zerreißen, müsste er mit ansehen, dass eines seiner Geschöpfe verloren geht. Deshalb heißt es im Evangelium der Liebe, dem Johannesevangelium: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (3,16) Liebe gibt eben Alles. Und Gott zeigt, wie das geht.
05.12.24
Ich kann eine Predigt nicht einfach so mit Amen enden lassen. Ich muss danach die Worte sprechen, die heute Lehrtext sind: „Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.“ (Philipperbrief 4,7) Wenn mich Dummheit und Bosheit unter der Woche fassungslos, wütend und manches Mal auch ohnmächtig zurücklassen, füge ich nach der Predigt noch das Wort „Unvernunft“ ein. Dann fühle ich mich besser. Der Satz beschließt eine Passage im Philipperbrief, in der Paulus die Gemeinde ermahnt, in Einigkeit zu leben und zu bleiben. Er weiß, dass sie sich zwar darum bemüht, aber es selbst nicht schaffen kann. Deshalb entlastet er die Gemeinde, indem er ihr einen Trost zuspricht: Ich weiß, dass alles, was ihr seid, denkt und tut, im Frieden Gottes bewahrt ist! Diese Zusage kommt aus der Dankbarkeit des Paulus für diese Gemeinde, zu der er ein gutes Verhältnis hat. Es sind keine Konfliktlinien zwischen ihm und der Gemeinde in dem Brief erkennbar. Weil Paulus von anderen Gemeinden wie z.B. Korinth weiß, wie zerbrechlich Einigkeit und Frieden sein können, betont er hier so eindringlich das „Bewahrt sein“. Man hat den Eindruck, dass er die Gemeinde geradezu darauf einschwört, die ihr geschenkte Einigkeit nicht aufs Spiel zu setzen. Vermutlich hat Paulus diesen Brief während seiner Gefangenschaft in Rom um das Jahr 60 n.Chr. geschrieben. Die Gemeinde in Philippi ist die älteste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Als Paulus den Schritt nach Europa wagte, hatte er zugleich einen entscheidenden Schritt zur Eigenständigkeit vollzogen. Das war um das Jahr 50 auf der zweiten Missionsreise. In Philippi begegnete er der selbständigen Purpurhändlerin Lydia, die sich taufen ließ und so die erste „Christin“ Europas wurde. In Philippi wird es keine Synagoge, wohl aber eine jüdische Gebetsstätte gegeben haben. Der Name der Stadt war Colonia Julia Augusti Philippiensis. Denn sie war unter Philipp II. von Makedonien, dem Vater Alexander des Großen, gegründet worden und unter Antochius und Octavianus mit Römern und römischen Kriegsveteranen besiedelt worden. In diesem Brief geht es Paulus um Jesus als Vorbild und Urbild. Er ist ihr Friede. Er stiftet ihre Einheit.
Es lohnte sich, einmal den Worten des ältesten Hymnus der Christenheit nachzuspüren, den Paulus im Philipperbrief wiedergibt. Er steht in Kapitel 2,5-11 und zeichnet den Christusweg so, dass er auch für einen Menschen begehbar sein kann.
04.12.24
Ich verstehe ich nicht, warum Martin Luther vom Jakobusbrief als einer „strohernen Epistel“ gesprochen hat und ihn deshalb im Ranking des Neuen Testaments nach hinten setzte. Dabei spricht der Jakobusbrief eine Wahrheit aus: als Christ reicht es nicht zu glauben. Der Glaube muss sich in einer glaubwürdigen Existenz erweisen. Dem heutigen Lehrtext geht ein – wie ich finde – hymnischer Text voran: „Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige seine guten Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit sind, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften.“ (3,13-18; 3,18 heutiger Lehrtext) Das hat er doch auf den Punkt gebracht, oder? Er spricht von einer Weisheit, die von oben kommt und stellt ihr die üblen Dinge auf der Erde gegenüber (Neid, Streit, Unordnung, böse Dinge). Oben ist also der Gegensatz von irdisch. Die Weisheit (griech.: sophia) ist die Botin des Himmels, die Platz sucht in unseren Herzen. Mit der Weisheit ist ausgedrückt, was das Miteinander in Gott selbst prägt und sich auf die Menschen auswirken möchte. Der Jakobusbrief wird nicht müde zu betonen, dass es auch auf unser Tun (Luther würde „Werke“ sagen) ankommt. Und damit ist auch die Zielgruppe klar. Friede und eine gerechte Welt wird es nur für die geben, die dem Frieden den Vorrang geben. Dabei klingt an, wen Jesus in der Bergpredigt beglückwünscht hat: Selig die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen (Mt 5,9). So nah ist der Jakobusbrief an Jesus dran. Martin Luther mit seiner bahnbrechenden Entdeckung des „Gerecht sein vor Gott ohne eigene Werke“ klingt hier wie ein Fremdkörper. Denn Jakobus geht es um die Glaubwürdigkeit eines Christenlebens, das sich in guten Werken verwirklicht. Damit kann nur gemeint sein, dass sich ein Christ Christus und seinem Auftrag verpflichtet weiß und weit weg davon ist, Gott damit imponieren zu wollen. Deshalb: unbedingt mal den Jakobusbrief lesen! Im Ganzen! Sind nur 5 Kapitel!
03.12.24
Samuel, der Königsmacher. Geboren aus den Tränen seiner Mutter Hanna und dem Aufhorchen Gottes auf deren Schmerz. Samuel, ein besonderer Junge von Anfang an. Also von da, wo kein Mensch hineinsieht, wohl aber Gott seine Wirkung erzielen kann. Seine Mutter hatte in Elkana einen Mann, der sich um sie sorgte, weil sie keine Kinder bekommen konnte und sie liebevoll fragte: „Hanna, warum weinst du, und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne?“ (1. Samuel 1,8) Seine tiefe Liebe zu Hanna konnte ihren Schmerz des „verschlossenen Schoßes“ nicht mildern. Doch sie fasste allen Mut zusammen, ging ins Heiligtum von Silo (an heiligen Orten geschieht Unfassbares!) und betete: „Wenn du mir, Gott, einen Sohn schenkt, gebe ich ihn dir zurück. Aber bitte lass mich das Glück erleben!“ (1. Samuel 1,11). Der Priester Eli sah sie und konnte offenbar Lippenlesen. Hanna wurde schwanger und brachte Samuel zu Welt. Er sollte einer der bedeutendsten Propheten Israels werden. Er wurde Novize bei Eli und hatte bald den direkten Draht zu Gott. Den nutzte er. Im bewährten Zusammenspiel von GOTT und sich (1. Samuel 9,13) sollte er Saul zum ersten König des Volkes Israel salben. Das geschah nur zwischen den beiden. Saul wurde nicht gefragt, ob er das wollte. Es heißt: „Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf Sauls Haupt und küsste ihn und sprach: Siehe, der HERR hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt.“ (1. Samuel 10,1) Später dann wurde Saul vom Volk zum König proklamiert. Samuel hatte offenbar den Richtigen ausgesucht. Saul war erfolgreich. Er war der Primus, bis er gegen den Willen Gottes verstieß. Von da an ging es bergab mit ihm. Er sollte durch David ersetzt werden, den wiederum Samuel zum König salbte (1. Samuel 16,1ff.). So war der Beginn des Königtums von Israel von einer Eigenart bestimmt: der rechtmäßige König Saul wusste nichts davon, dass der junge Mann David, der an seinen Hof kam, bereits von Samuel zu seinem Nachfolger gesalbt worden war. Ein Doppelkönigtum. Ränkespiel? Hohe Politik, verschlungene Pfade. Manchmal habe ich den Eindruck, da ist etwas nicht zielführend. Und Gottes Rolle dabei? Rühmlich? Vorbildlich? Ein Fehltritt von Saul (1. Samuel 15,1ff.) – und das war´s dann mit dem übertragenen Amt. Kann´s so gehen? Ich ahne, wie drückend die Last eines hohen politischen Amtes (Prophet und König damals) auch heute sein muss.
02.12.24
Da ist dieser Dreierschritt „Kommen – Hören – Tun“. Für Jesus gehören diese Drei unlöslich zusammen. Zu ihm kommen und sich bei ihm ausruhen – reicht nicht. Auf ihn hören, ohne seine Nähe zu suchen – reicht nicht. Tun, was er sagt, ohne auf ihn zu hören und in seiner Nähe zu leben, ist zwar prima – reicht letztlich aber auch nicht. Wie ist das in heutigen Zeiten? Jesus dürfte mit dieser Haltung auf Granit stoßen. Ist der heutige Trend nicht der, dass man selbst bestimmt, was man will? Und da soll das akzeptieren werden, was Jesus sagt: „Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie…“ (Lehrtext von heute aus Lukas 6,47.48) Voraussetzung allen Hörens und Tuns ist demnach die Bewegung auf Jesus zu. Es kommt auf diesen Impuls an, dass ich mich zu ihm aufmache und in seiner Nähe sein will; dass ich dieses Bedürfnis spüre, in seiner Nähe sein zu wollen, weil da diese Liebe ist, durch die ich ein Mensch sein darf. Das Wichtigste ist es also, bei IHM sein und zu ihm gehören wollen. Daraus wird in einem nächsten Schritt das „Ihm-Gehören-Wollen“ (siehe auch Heidelberger Katechismus Frage 1). Und wenn ich ihm gehöre, höre ich (nur noch) auf ihn. Dann ist es nur konsequent, auch in seinem Sinn zu handeln. Für Menschen, die sich als autonom verstehen, ist das eine Zumutung und vielleicht sogar eine Unmöglichkeit. Auch im Hinblick darauf, dass sie sich nichts von den Dreien als Einzelnes herauspicken können. Denn Jesus begründet seine Haltung mit einem Vergleich: wer sich auf diesen Prozess von „Kommen – Hören – Tun“ mit IHM einlässt, hat das Fundament für sein Lebenshaus gelegt (6,48ff.). Kurzum: auf diesen Drei kann man aufbauen. Pickt man sich eins heraus, riskiert man eine Schieflage im Lebensaufbau. Also: Es liegt an dir, dich zu IHM aufzumachen, weil du es willst! Weil du keine halben Sachen mehr machen und endlich wissen willst, wem du gehörst.
01.12.24
Endlich! wird der Psalm 24 im Ganzen zum 1. Advent gesprochen. Es hat mich schon immer geschmerzt, dass man ihn zerteilt hat, damit er zum Beginn („Macht die Tore weit…“) der kirchlichen Adventszeit passt. Dabei drückt der Psalm im ersten Teil auf bedrückende Weise aus, worauf es in der „Erwartungszeit“ des Advents ankommt: „Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug: der wird den Segen des Herrn empfangen…“ (24,3-5) Niemand hat das. Keiner bringt das mit, wenn er dem heiligen Gott im Tempel begegnen möchte. Nicht nur die Füße sind dreckig von der Wallfahrt. Auch das Herz ist verunreinigt und die Hände erzählen von schmutzigen Handlungen. Es ist hier nicht die Frage, ob jemand perfekt ist. Es ist hier auch nicht die Frage: Hast du dich bemüht? Die adventliche Frage ist: Bist du bereit, dich kritisch zu sehen? Im Advent wartet die Welt auf die Buße der Uneinsichtigen. Nichts weniger als dass sich etwas umdrehen könnte vom Stolz zur Demut, vom Selbermachen wollen zum Bedürftig sein, vom Egoismus zum zärtlichen Miteinander. Wenn die vor den Toren Wartenden zu dieser Umkehr bereit sind und sich dazu bekennen, soll der Torwächter dem Befehl nachkommen: „Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Ehre einziehe…“ in die Herzen der Bußfertigen! Adventszeit ist alles andere als zauberhaft. Sie verbreitet keine wohlige Stimmung. Sie ist nicht die vorweg genommene Weihnacht. Advent ist die Erwartung, dass was Entscheidendes passiert: in den Herzen der Menschen wird Gott die Ehre gegeben. Denn er hat die Grundlagen des Lebens geschaffen (24,1.2). Die Adventszeit dauert 4 Sonntage. Was in ihr beginnen kann, ist ein „adventlich gestimmtes Leben“, das Zug um Zug auf Gottes Kommen wartet und Tag für Tag IHM die Ehre gibt.
30.11.24
Die Liebe sucht stets ein Gegenüber. Der Satz „Ich liebe…“ ist nicht vollständig. Er verlangt nach einer Fortsetzung. Da muss ein Zusatz kommen wie „Ich liebe dich!“ oder „Ich liebe Erdbeeren!“ oder „Ich liebe meinen Mann!“ Und in der heutigen Losung heißt es: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“ 5. Mose 6,5. Wie soll das gehen? Also tiefer blicken. Der Satz aus einer Rede des Mose steht in der Thora und dort so ziemlich am Ende. Die Aufforderung Gott zu lieben steht also nicht am Anfang, sondern kommt später – möglicherweise mitten im Leben oder vor einem Übergang, wenn was Neues beginnt. So war es denn auch. Das Volk Israel gibt es nur, weil es diesen Gott gibt. Er hat ein Auge auf es geworfen, als es noch kein Volk, sondern ein Häufchen Elend in Ägypten war. Sklaven also hatten es Gott angetan. Sie haben sein Herz im Sturm erobert. Er fand, es sei jetzt mal an der Zeit, ein großes Thema in die Welt zu setzen: die Freiheit. Seinen Plan hat er durch Mose verwirklicht. Die großen Ägypter ließ dieser Gott ziemlich klein aussehen. Und dann waren die Sklaven (man sagt auch habiru zu ihnen, aus denen später die Hebräer wurden) freie Menschen. Auf dem Weg mit ihrem Gott wurden sie zu seinem Volk. Der Weg ins neue Leben führte durch die Wüste. Dort hat sie Gott in die Lehre genommen und für ein Leben mit ihm präpariert. Die Anleitung für ein gelingendes Leben ist in der Thora niedergeschrieben. An sie erinnert Mose das Volk vor dem Übergang ins Land des Lebens. Dazu gehört: „Du sollst Gott lieben.“ Man kann auch übersetzen: „Du wirst Gott lieben.“ Liebe geht nur ganz. Deshalb mit „ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft“. Den Satz kannst du am besten im Gebet fühlen. Wenn du sagst, ohne dass dich jemand hört. „Ich liebe dich. Dir verdanke ich mein Leben.“ Das geht durch und durch!
29.11.24
Der längste aller Psalmen ist der Psalm 119 („Herr, ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum“ Losung von heute Psalm 119,14). Er umfasst 22 Strophen nach dem hebräischen Alphabet. Obwohl so lang hat er doch nur ein Thema: die Thora=Gottes Weisung und Wort, seine Zeugnisse, Ordnungen, Satzungen, Gebote und Rechtssätze. Die Thora birgt Wunder (V18) und setzt Recht (Vv14.43.75.108). Sie ist ewig (89-91). Sie ist wahr und gerecht (Vv137.142). Der Psalm ist eine einzige Lobpreisung Gottes und seiner Thora. So mancher Zaddik (=Bewährter, Gerechter) mag beim Rezitieren des Psalms in eine stille Ekstase geraten sein. Thora ist hier als Wortgeschehen zu verstehen, d.h. als mündliche Unterweisung einzelner. Das Verhältnis zwischen einem Zaddik=Gerechten und Gott wird als Liebesverhältnis beschrieben („Ich liebe deine Thora.“ Vv97.113.163.165). Der Bewährte erscheint hier keineswegs als Mann des Gesetzes oder gar pingeliger Gesetzlichkeit, sondern als aufrichtig und leidenschaftlich Liebender! Diese Liebe gilt einem Gott, der nur im Diesseits und – zumal in seiner Thora! – nur für das diesseitige Leben der Menschen redet und handelt. Von Jenseitserwartung keine Spur! Die Thora ist kein unterjochendes Gesetz, sondern eine unerschöpfliche Quelle der Belebung (Vv25.40.50.77.93.107.149.156), der Erquickung (Vv24.4.70.77.174), des Trostes (Vv50.52.76), der Freude (Vv14.111.162), der Lust (Vv16.35.92) und des heftigen Verlangens (Vv220.30.40.81.82.123.131). Emmanuel Lévinas schreibt: „Das Gebot, das den Juden umtreibt, ist kein moralischer Formalismus, sondern die lebendige Anwesenheit der Liebe…Das Gesetz ist die – lästige – Liebe.“ Lästig deshalb, weil sie so konkret in das individuelle und soziale Leben eingreift. Es gilt also zweierlei für Christen: die Liebe der Juden zur Thora anzuerkennen und sich selbst zu fragen: Was in meinem Glauben hat eine so weitreichende Wirkung auf mein Inneres und meine Lebensgestaltung wie die Thora für einen Juden?
28.11.24
Bei einem Anfang nimmt man sich vor, alles richtig zu machen. Bei Eltern ist das so, wenn das erste Kind zur Welt kommt. Bei jungen Erwachsenen ist das so, wenn sie zusammenziehen. Bei Ehepaaren ist das so, wenn sie in die Ehe starten. Beim Berufsstart ist das so und wenn ein neues Schuljahr beginnt. Als ich nach einer eher bescheidenen Schulkarriere in das Abenteuer Theologiestudium startete, nahm ich mir vor, mich im Notenbereich zwischen 1-2,5 zu bewegen. Ist mir bis auf eine Ausnahme auch gelungen. Der Beginn braucht diese Energie, es gut machen zu wollen und dabei zu bleiben. Das meinte auch der Prophet Jesaja, als er zum Volk sagte: „Ihr sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener Gottes nennen.“ (61,6) Eine große Erwartung! Zu groß? Der historische Kontext ist ernüchternd. Nach zwei Generationen im babylonischen Exil (587-539 v.Chr.) ermöglichte es der Perserkönig Kyros den Israeliten, in ihr Land zurückzukehren. Dieses Land sieht aber immer noch so aus, wie es die Babylonier zurückgelassen haben: überall Trümmer, alles kaputt! Kein Land, das zu einem guten Leben einlädt, aber ein Land, das nach „Bau mich auf!“ ruft. Ärmel hochkrempeln, Steine umdrehen, Mund abputzen und weiterschaffen! Man schaue sich nur Esra und Nehemia an! Doch für diesen Neuanfang im alten Land brauchte es auch eine innere Haltung. Jesaja meint, dass die Pioniere Priester und Diener Gottes sein sollen. So wie es in der Thora (5. Buch Mose) steht. Ein Priester kennt nur die Beziehung zu Gott. Er hat sein Leben IHM gewidmet. Wieder taucht das Thema der „intakten Gottesbeziehung“ auf. Sie federt Rückschlage ab, hilft durchzuhalten, innezuhalten, weiterhin zu glauben. Die Chance ist da. Sie muss nur ergriffen und gelebt werden!
27.11.24
Das letzte Kapitel des zweiten Briefes an die Gemeinde in Korinth hat es in sich. Paulus kündigt seinen dritten Besuch an und schickt voraus, was die Jesusgläubigen erwartet, wenn er zu ihnen kommt: „…dann will ich euch nicht schonen.“ (13,2) Warum? Weil sie einen Beweis verlangen, dass Christus in Paulus mächtig ist. Das greift Paulus geschickt auf, indem er sagt: gerade weil er so schwach wirkt, ist Christus in ihm stark. Wenn er also zu ihnen kommt, dann zwar äußerlich schwächlich aber innerlich stark in Christus. Nachdem er den Erweis der Gegenwart Christi in ihm selbst erbracht hat, wendet er sich den Gläubigen zu: „Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüft euch selbst! Erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist?“ (13,5) Paulus steigert das Schwach-Stark-Schema zur Klimax: „Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid. Um dies beten wir auch, um eure Vollkommenheit.“ (das letzte Wort heißt im Griechischen katartisis; in ihm steckt das Wort „Reinigung“ und meint somit eigentlich „Festigung“. Es kommt im NT nur 1x und zwar hier vor). Jetzt versteht man auch den heutigen Lehrtext: „Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein!“ (13,11) Damit nennt Paulus die Grundpfeiler des gemeindlichen Miteinander. Und um diese Gesinnung zu bekräftigen, fordert er die Gläubigen auf, sich mit dem heiligen Kuss zu grüßen (13,12). Zärtliche Christen! So – glaube ich – machen es die Franzosen. Warum nicht auch wir?
26.11.24
Die heutige Losung („Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland.“ Jesaja 45,17) mutet wie eine Unterschrift der Gottesrede an, die in 45,1 beginnt. Wenn man da einsteigt, verschlägt es einem den Atem. Denn der Gott Israels nennt Kyros, den König des Großreiches Persien, seinen Messias. Und weiter sagt ER, dass Kyros seine rechte Hand sei und ER vor ihm Völker unterwirft und andere Könige entwaffnet, damit ihm die Türen zur Macht geöffnet werden und sich nicht mehr verschließen. Warum Kyros? Warum soll er der Messias=Gesalbte sein? Das hat einen handfesten Grund. Kyros war der König, der mit einem Edikt 539 v.Chr. den einst exilierten Israeliten erlaubte, nach Judäa zurückzukehren. Messias ist also der, der an entscheidender Stelle für das Wohl des Volkes Israel handelt und ihm sein Existenzrecht gewährt. Überhaupt scheint ER keine Scheu vor den Großen und Mächtigen zu haben. Die mächtigen Ägypter, die arabischen Kuschiter und die Riesen von Seba werden zu IHM kommen und ER wird sie Kyros übergeben. Wer will da der Behauptung der Unterschrift widersprechen, dass Gott ein verborgener Gott sei!? Er entscheidet, wen er zum Messias macht und sei es der Herrscher eines fremden Landes. Wen würde dieser verborgene Gott heute zum Messias seines Volkes ausrufen?
25.11.24
„Selber schuld!“ Stimmt! Es kommt nur drauf an, wer das sagt. Sage ich es zu mir selber, dann kann mir das niemand nehmen. Auch der gut gemeinte Rat „Du bist nicht schuld!“ hilft da nicht weiter. Man muss jedem Menschen sein Schuldbewusstsein lassen. Es ist ja trotzdem da, auch wenn es einem jemand ausreden will. Außerdem imponiert mir ein Mensch, der ein Versäumnis eingesteht. Es gibt bereits zu viele Menschen, die eigene Versäumnisse von sich weisen oder sie relativieren. Menschen mit einem „schlechten Gewissen“ haben meinen Respekt. Sie sind auf einem guten Weg. Allerdings muss das schlechte Gewissen in ein gesundes Selbstbewusstsein eingebettet sein. Kein Mensch ist dazu bestimmt, ständig mit gesenktem Kopf durch die Gegend zu laufen. „Selber schuld!“ Stimmt! Gefällt mir aber nicht, wenn das die Worte eines selbstgerechten Menschen an mich sind und er das auch noch mit einer Bestimmtheit sagt, als stünde ich kurz vor einer längeren Gefängnisstrafe. Also am liebsten lassen wir das! „Selber schuld!“ wagt Jeremia zum Volk Israel zu sagen (heutige Losung aus Jeremia 2,17: „Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, sooft er dich den rechten Weg leiten will.“). Daraus spricht eine Autorität, die dem Volk Israel seine Untreue zu Gott vorhält. Jeremia will dem Volk die Augen öffnen und sagt, dass aus einer intakten Gottesbeziehung Gutes kommt. Unzuverlässigkeit, Untreue oder Selbstherrlichkeit in dieser Beziehung führen dann zu Missständen. „Selber schuld!“ Eine intakte Gottesbeziehung wirkt sich direkt auf unsere Beziehungen zueinander aus. Was dort gilt, gilt auch hier: durch Einsicht und Vergebung ist Neuanfang möglich! Es hilft, auch mal zu fragen: Was ist das Gute am Schlechten? Gegen das ganz schlechte Gewissen hilft auch, sich zu sagen: Ich kann auch was Gutes!
24.11.24
Am Ende des Kirchenjahres rücken unter dem Schirm der Ewigkeit die Toten in den Mittelpunkt. Das Christentum hat in Folge des Judentums mit den Toten immer ernst gemacht. In den Katakomben wurden die Gottesdienste unterirdisch mit den Toten gefeiert. Als das Christentum legalisiert war, wurden die Toten in den Kirchen bestattet. Da waren sie also auch immer präsent. Und dann kamen die Friedhöfe. Die Toten haben sich also um die Kirche herum versammelt, in denen die Lebenden ihre Gottesdienste feiern. Warum ist das so? Weil im Kern des Christentums ein Glaube zählt: dem Tod ist die Macht genommen. Die Kraft Gottes hat die Einflusssphäre des Todes geschmälert bzw. begrenzt. Glaubende erreicht der Tod nicht mehr in seiner Sogkraft nach unten. Deshalb können die Christen die Toten würdigen. Die Angst, die der Tod gerne hätte, ist ihnen genommen. Sie leben geborgen in Gottes Liebe.
Dazu auch die heutige Predigt zu Psalm 126 unter „Predigten“.
23.11.24
Paulus hatte einiges klarzustellen. Allzu schnell schliddern die Gläubigen in einen Glauben hinein, der ins Bodenlose führt. So geschehen in Korinth. Im 15. Kapitel seines ersten Briefes widmet sich Paulus deshalb dem zentralen Thema des Glaubens – die Auferstehung. Es gab Leute in der Gemeinde, die leugneten die Auferstehung, obwohl sie glaubten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Paulus stellt also eine innere unauflösliche Verbindung her zwischen Jesus als Erstem, der auferstanden ist und der allgemeinen Auferstehung der Toten am Ende der Weltzeit. „Wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden.“ (15,16) Wird ein Teil der Auferstehung geleugnet, ist der Glaube für die Katz. Sprich: alles hängt davon ab, ob geglaubt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und es deshalb auch eine auch eine allgemeine Auferstehung der Toten geben muss. Erst dieser Glaube begründet das Recht zu predigen. (15,14). Ich erinnere mich an ein früheres Gemeindeglied, das einmal mit Tränen in den Augen zu mir kam. Es war nach einem Ostergottesdienst. Die Frau erzählte mir, dass sie bis zu diesem Gottesdienst in einer Art Erschütterung lebte, weil mein Vorgänger in einem früheren Ostergottesdienst erzählte, dass er nicht an die Auferstehung glauben kann. Im Erleben dieser Frau wurde mir klar, dass der Glaube eines Christen in der Auferstehung wurzelt wie die Rebe vom Weinstock abhängig ist. Von daher versteht man jetzt auch den heutigen Lehrtext: „Werdet wieder nüchtern und lebt, wie es Gott gefällt. Ich muss zu euer Schande sagen: Einige von euch kennen Gott nicht.“ (15,34) Also: Werde dir im klaren darüber, wie du zur Auferstehung stehst und was sie für deinen Glauben bedeutet!
Ewigkeitssonntag, 24.11.24 um 10:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Eichstetten / Predigt zu Psalm 126
22.11.24
„Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.“ (heutige Losung aus Psalm 86,11) Man muss wissen, dass das einer betet, der sich selbst als „chassid“=Gerechter bezeichnet (V2). Andere übersetzten den „chassid“ gerne als „Frommen“. Dieses Wort ist im deutschen Sprachgebrauch jedoch pietistisch gefärbt. Fromm sein gibt nicht vollständig wieder, was im Hebräischen der „chassid“ verkörpert. Nämlich keine reine individuell verinnerlichte Erlösung wie im Pietismus. Sie ist im Grunde unisraelitisch, unjüdisch. Gershom Scholem betont, „dass es die besondere Position des Judentums in der Religionsgeschichte bezeichnet, dass es von…reiner Innerlichkeit der Erlösung gar nichts hielt…Eine Innerlichkeit, die nicht im Äußerlichsten sich darstellt, ja mit ihm nicht in das Letzte verbunden wäre, die gilt hier nichts.“ Jüdische Glaubenserfahrung behält immer das Ganze im Auge und lässt einen Dualismus, eine Scheidung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, Leib und Seele nicht zu. Deswegen ist der „Chassid“ nicht einfach „fromm“. Martin Buber bezeichnet ihn als „Bundestreuen“ oder „Thoratreuen“, Hermann Cohen auf dem Hintergrund von „chessed“ (=Güte, Solidarität) als „der Liebende“. Der „chassid“ liebt die Thora genauso wie der Christ seinen Christus. Was macht der „chassid“? Er hält sich an Gott, indem er zu ihm ruft (Vv1-6) und seine Hilfe erfleht am Tag des Bedrängt werden (V7) und der Bedrohung seines Lebens (V14). Er bittet Gott, dass er ihn mit seiner Kraft stärken möge (V16). „Überall, wo du die Größe Gottes findest, dort findest du auch seine Demut.“ (Rabbi Jochanan) Es macht also Sinn, sich in die Psalmen zu vertiefen.
21.11.24
Die heutige Losung (Jesaja 50,10) ist Teil einer Rede des sog. „Gottesknechts“. Im zweiten Jesaja (Kapitel 40-55), der auch Trostbuch Israels genannt wird, gibt es vier Lieder des Gottesknechts. Das berühmteste davon steht in Kapitel 53 und ist der Verstehenshorizont für das Leiden Jesu. Man spricht auch vom leidenden Gottesknecht. Der Knecht ist im Alten Testament ein Würdetitel. Die wohl historische Person hat keinen Namen. So wird ihr Schicksal umso drastischer geschildert. Im Kontext der heutigen Losung nennt er Kennzeichen seines Leidens: Schläge auf den Rücken, Ohrfeigen, angepöbelt und angespuckt werden (50,6). Er sieht bei sich aber nichts Unrechtes. Deshalb kann er nicht verstehen, dass so mit ihm umgegangen wird (50,9). Er stellt seinen Peinigern eine Frage: „Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der der Stimme seines Knechts gehorcht, der im Finstern wandelt und in dem kein Licht scheint? Der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott!“ (50,10) Vermutlich erntet er für diese Frage nur Gelächter und Spott. Doch diese Frage sagt alles über ihn selbst aus. Sein Leben hat sich verfinstert. Es gleicht dem Zustand der Welt, bevor Gott in die Finsternis das Licht brachte. So sieht auch seine Innenwelt aus. Doch da ist noch etwas Unverfügbares. Es kann ihm ja alles genommen und Schlimmes angetan werden. Was ihm aber bleibt ist die Hoffnung auf den Gott, dessen Name für ihn Programm ist: „Ich bin für dich da. Und ich werde für dich da sein.“ Dieses Hoffnungslicht leuchtet in ihm. Aus dem Text in 50,4 hat Jochen Klepper 1938 das Lied gedichtet: Er weckt mich alle Morgen (EG 452).
20.11.24
Es gibt einen „hoffnungsvollen Fall“. Es ist der Weingärtner in einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat (Lukas 13,1ff.). Um es zu verstehen, braucht man die Unterhaltung davor. In Siloah ist ein Unglück passiert. Mehrere Galiläer sind beim Einsturz eines Turms ums Leben gekommen. Einige meinten dieses Unglück mit dem Verstoß gegen die Reinheitsvorschriften erklären zu können. Das ist die klassische Reaktion auf ein Unglück, das als reiner „Zufall“ Menschen trifft: die müssen irgendwie schuldig sein oder es „verdient“ haben. Es erübrigt sich zu sagen, dass so eine Denkweise zynisch, lieblos und eiskalt ist. Jesus verbietet solches Denken und wendet den Maßstab, der an die Verunglückten angelegt wurde, auf die an, die das behaupteten und sagt: „Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen.“ Es ist leicht, aus der Distanz zu urteilen. Jesus stellt eine Betroffenheit im wahrsten Sinne des Wortes her. Er erschreckt mit seiner Antwort die Urteilenden. Sie sollen über sich selbst erschrecken. Und darauf folgt das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Eigentlich ein Unding, denn der Feigenbaum ist ein Symbol immerwährender Fruchtbarkeit. Er stand in einem Weinberg. Genuss und Fruchtbarkeit sozusagen in guter Nachbarschaft. „Was nichts bringt, muss weg!“ sagt der nützlich denkende Mensch. Der „hoffnungsvolle Fall“ hält dagegen: „Nicht jetzt! Später! In drei Jahren! Kommt ja nicht drauf an, oder?“ Für jeden von uns: Sei geduldig mit dir, wenn´s nicht gleich klappt. Das Entscheidende muss reifen, bis es Früchte trägt. Und mach dir keinen Kopf über die Ursachen von Unglück. Es ist schlimm genug, dass es passiert.
19.11.24
Der heutigen Losung aus Psalm 124 merkt man die Erleichterung an. Ein Mensch ist dankbar für seine Freiheit. Existentiell greifbar wird diese Freiheit aber nicht mit dem Begriff „Seele“, sondern mit dem besser übersetzten Begriff „Leben“. Dann heißt der Satz: „Unser Leben gleicht dem Vogel, der dem Netz des Vogelfängers entschlüpfte: das Netz zerriss – und wir konnten entwischen!“ (Psalm 124,7) Äußerlich ist dieser Psalm ein Wallfahrtslied. Innerlich aber ist er ein Loblied der Befreiten und die Resonanz auf den Bittpsalm 123 und das bange Fragen, ob Gott Gnade walten lasse (Psalm 123,3). Nimmt man die Situation damaliger Wallfahrer, so war diese oft (lebens)gefährlich. Pilgerrouten konnten durch ein plötzliches Gewitter zur Falle werden. Niederstürzende Wildbäche schnitten Durchgänge ab und überfluteten Talböden und machten sie ungangbar. Oft fielen Räuber über die Wallfahrer her (Vers 2+3). Deshalb war es wichtig, in größeren Gruppen unterwegs zu sein. So konnte mancher Wallfahrer erleichtert aufatmen und sagen: „Noch mal davongekommen!“, was Gnade bedeutet. Diese Pilgererfahrung wurde zum Lebensgleichnis für einzelne und für die immer wieder bedrohte Existenz Israels. Das Netz, von dem hier die Rede ist, war eine Art Schlagnetz, das mit einem Stellholz versehen war und den Vogel, der sich auf der Lockspeise niederließ, unversehens erfasste. Der Psalm schenkt uns Heutigen eine Perspektive zum Verstehen unseres Lebens. Es ist wie eine Wallfahrt, ein Unterwegssein zu einem Ziel. Manche nennen es Himmel, andere Ewigkeit, wieder andere himmlische Heimat. Dabei ist es Gefahren ausgesetzt. Es werden uns Fallen gestellt. Wir erleben ein Eingefangen werden. Und können uns dann riesig freuen, dass eine „große Kraft“ das Netz zerriss, weil sie unsere Freiheit wollte und nicht will, dass uns nicht die Flügel gestutzt werden, sondern dass wir sie ausbreiten können. Und erleben, von Gottes Aufwind getragen zu sein.
18.11.24
„Freut euch in dem Herrn allewege; und abermals sage ich: Freut euch!“ (Philipper 4,4). Die heutige Losung klingt super! Freude – und das zu Beginn dieser Woche. Für die Freude muss es einen oder mehrerer Gründe geben. Meist richtet sich die Freude auf das, was kommt – ein schönes, bereicherndes, er-freuliches Ereignis. BMW findet Freude auch gut – Freude am Fahren, vor allem am schnellen Fahren. Die Werbung von BMW richtet sich an junge Leute und ich weiß nicht so recht, wo sie die Stange Geld hernehmen sollen für den Erwerb dieser Freude erregenden Karossen. Freude bei Paulus hat auch einen Grund. Er sitzt im Gefängnis. Er freut sich aber nicht darüber, dass er einsitzt. Er kann dem aber einen Sinn geben. Wörtlich sagt er: „Ich lasse euch wissen: So wie es um mich steht, befördert das die Verbreitung der Frohen Botschaft, für die ich alles gebe. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden.“ (Philipper 1,12.13) Später setzt er noch einen drauf und schreibt „Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Dank vor Gott kundwerden!“ (4,6) Erstaunlich für einen Gefangenen. Wäre er nicht im geistlichen Trostraum („in dem Herrn=Christus“) beheimatet, wäre er ein Verlorener: verloren an seine Verzweiflung, an seinen Hader und Hass. Die Freude darüber, dass man ihm alles nehmen kann außer dass er Christus gehört, übersteigt alles Diesseitige. So kann er sogar die frei Lebenden trösten und ermahnen (4,1-9). Paulus als Vorbild? Unbedingt! Es liegt in deiner Hand, die un-fassbaren Situationen deines Lebens umzudeuten. Der Glaube ist dabei dein Freund.
17.11.24
Im heutigen Predigttext zum Volkstrauertag Römer 14,7-12 spricht der Apostel Paulus vom „Leben und Sterben“. Damit beschreibt er unsere Wirklichkeit. Sie ist bildlich gesprochen in die größere Wirklichkeit von „Himmel und Erde“ eingebettet. Da höre ich schon den Einspruch des autonomen Menschen. Er bejaht das Leben so lange und insofern, als er es nach seinen Vorstellungen formen kann. Deshalb spricht er mit hoher Leidenschaft vom „Leben“ und leugnet das „Sterben“, weil er weiß, dass hier seine Autonomie endet. Paulus bejaht beides und vertieft es mit dem Zusatz „für den Herrn“. Damit verleiht er beidem eine göttliche Würde. Wenn das Sterben für den autonomen Menschen die ultimative Krise bedeutet, so für den Glaubenden die ultimative Wende. Wo sich der autonome Mensch völlig dem Diesseits hingibt, weiß sich der Glaubende angewiesen und getragen. Und er erkennt im Jenseitigen die Tiefendimension seines Daseins. Er schaut mit dem glaubenden Auge nach drüben. Was der autonome Mensch niemals „sehen“ kann und auch nicht anerkennen wird ist die andere Wirklichkeit, die Paulus heute ausspricht: Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden (Römer 14,10).
Mehr dazu auch in der heutigen Predigt unter „Predigten“
16.11.24
Eine krisenbeladene Beziehung ist das zwischen Gott und seinem Volk. So mutet es jedenfalls an, wenn man im Propheten Jeremia ein paar Kapitel liest. Die Losung von heute aus 33,9 („Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue.“) lässt das nicht vermuten. Man versteht diese Worte, wenn man sie im Kontext liest. Es sind Worte Gottes an Jeremia, der im Gefängnis sitzt. Eingebuchtet hat ihn König Zedekia zu der Zeit, als Nebukadnezar, König von Babylon, Jerusalem belagerte. Zedekia warf Jeremia seine Prophezeiung vor: „Warum weissagst du und sprichst: So spricht der Herr: Siehe, ich gebe diese Stadt (spricht Jerusalem) in die Hände des Königs von Babel, und er soll sie erobern, und Zedekia, der König von Juda, soll den Chaldäern (gleichbedeutend mit Babylonier) nicht entrinnen, sondern ich will ihn dem König von Babel in die Hände geben, dass er von Mund zu Mund mit ihm reden und mit eigenen Augen ihn sehen soll?“ (32,3.4) Zedekia bezichtigte Jeremia des staatspolitischen Verrats. Dass aber Jeremia nur aussprach, was ihm Gott aufgetragen hatte, konnte und wollte Zedekia nicht wahrnehmen. Der Grund liegt in seiner gestörten Gottesbeziehung. Muss es, frage ich mich, immer erst zum Äußersten kommen, bis einer oder ein Volk kapiert, dass es in einer Störung lebt? Gott hat für sich entschieden, Jerusalem den Babyloniern zu überlassen. Doch es zerreißt IHM das Herz. Er will es im Grunde nicht. Doch manche horchen erst auf, wenn es kracht und donnert. Gott will Gutes tun. Zum Zeichen dafür, dass sich Gott an dem ergötzen kann, dass er Gutes will und sein Volk in Frieden in diesem Land wohnen und leben kann, sollte sich Jeremia einen Acker kaufen (K. 32). Was er dann auch unter Zeugen getan hat. Daraus folgt: Es gibt nicht nur die eine Sichtweise einer (politischen) Krise und daher auch nicht die eine Lösung. Die weitreichendsten Folgen hat aber eine krisenbeladene Gottesbeziehung. Also: Mache dich ehrlich und lass dir was sagen!
15.11.24
Getragen – gesehen – erkannt. Die drei entscheidenden Verben in den heutigen Losungen. Mose muss sein Volk daran erinnern, dass es von seinem Gott getragen wurde auf seinem Weg, den es gehen musste (5. Mose 1,31). Dieses Erinnern ist deshalb wichtig, weil das Vorankommen und das Ziel erreichen sich die Menschen oftmals voreilig auf die eigene Fahne schreiben. Getragen werden ist ein Gefühl. Tief geht es, wenn ich es wirken lasse und mir sage: „Ich bin getragen.“ Für mich ergibt sich aus diesem Gefühl die eine Frage: „Was soll mir passieren, wenn ich getragen bin?“ Mose bewegt das Herz des Volkes, indem er es tröstet und sagt: „Gott ist bei euch. In seiner Liebe trug er euch und wird es weiter tun.“ Was für ein Bild: Ein Papa trägt sein Kind! So trägt Gott sein Volk! Kann das Volk das sehen? Das Sehen ist hier ein Erkennen, ein tieferes Hineinsehen in die Wirklichkeit des Weges. Wie es Jahrhunderte später auf dem Weg nach Emmaus war (Lukas 24.35). Äußerlich gesehen sind da zwei Männer auf dem Heimweg. Später sind sie verwandelt, weil sie, versunken in ihre Sorgen und Ängste, erst beim Brotbrechen den Auferstandenen erkannten. Das heißt für uns: es fällt uns erst später wie Schuppen von den Augen (hoffentlich!), dass wir da getragen und begleitet wurden, wo wir meinten, es wäre nur auf unsere Kräfte angekommen. Sprich: der Glaube hilft uns zu erkennen, dass es eine Kraft gibt, die uns durchträgt. Warum das wichtig sein soll? Damit man nicht an sich selbst verzweifelt.
14.11.24
Himmel und Erde sind ein Bild für das, was wir moderne Menschen Wirklichkeit nennen. Die hebräische Sprache kennt keine Abstraktionen. Sie spricht in Bildern. So muss man die heutige Losung hören: „Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist des Herrn, deines Gottes.“ (5. Mose 10,14) Dass es bei der Erde keine Doppelung wie beim Himmel gibt, könnte damit erklärt werden, dass der Himmel weiter ist als die Erde. Der Himmel kann nicht ermessen, die Erde aber wohl abgeschritten werden. Deshalb musste Mose die beiden Himmel sprachlich so ausdrücken, dass es gedanklich keinen Rest gibt. Also: Himmel und Erde gehören Gott. Warum? Weil er sie geschaffen hat. Es sind Worte, die in eine Rede des Mose an das Volk eingebettet sind. Das Volk Israel befindet sich kurz davor, im verheißenen Land sesshaft zu werden. Mose erinnert das Volk noch einmal an seinen Fehltritt, als es sich einen Gott machte und Reigen um ihn tanzte, weil Mose Rückkehr sich verzögert hatte. Für den neuen Lebensabschnitt soll gelten, was vereinbart wurde: das Volk bekam die Freiheit von seinem Gott und wird IHN dafür lieben, ihm dienen und auf seinen Wegen gehen (5. Mose 10,12). Wir kennen das: man nimmt sich viel vor und verspricht, das Beste aus dem neuen Lebensabschnitt zu machen. Doch es geht nicht lange, dann kommt das erste Scheitern. Das ist so. Doch die Beziehung hält, weil beide zum Vergeben bereit sind und einer zum Gnädig sein.
13.11.24
Mitten aus dem Lobgesang der Hanna die heutige Losung: „Der Bogen der Starken ist zerbrochen, die Schwachen sind umgürtet mit Stärke.“ (1. Samuel 2,4) Das geht zu Herzen, aber wirklich! Hier strömen der Dank und die Freude aus einer jungen Frau heraus, die Gott mit der Schwangerschaft beschenkt hat. Und für alle Männer jetzt mal die sorgenden Fragen ihres Mannes Elkana: „Hanna, warum weinst du, und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne?“ (1. Samuel 1,8) Seine tiefe Liebe zu Hanna konnte ihren Schmerz des „verschlossenen Schoßes“ nicht mildern. Doch danach fasste sie allen Mut zusammen, ging ins Heiligtum von Silo (an heiligen Orten geschieht Unfassbares!) und betete. „Wenn du mir, Gott, einen Sohn schenkt, gebe ich ihn dir zurück. Aber bitte lass mich das Glück erleben!“ (1. Samuel 1,11). Eli, der Priester, sah sie und konnte offenbar Lippenlesen. Hanna wurde schwanger und brachte Samuel zu Welt. Sie bekam danach noch drei Söhne und zwei Töchter (1. Samuel 2,21). Ihr erster Sohn Samuel sollte einer der bedeutendsten Propheten Israels werden. Er wurde Novize bei Eli am Heiligtum in Silo. Und hatte bald den direkten Draht zu Gott. Der Lobgesang, dem die Erleichterung von Hanna anzumerken ist, quillt über vor Gotteslob. Von ihm führt der direkte Weg zum Lobgesang der Maria, der Mutter Jesu (Lukas 1,46ff.) Männer! Was wäre unser Glaube ohne die Frauen – sowohl im Judentum als auch im Christentum!
12.11.24
Paulus kämpft. Er kämpft um die Menschen, die ihm geglaubt haben. Und er kämpft gegen die, die sie ihm wegnehmen wollen. Seine Gegner treffen ihn an einem wunden Punkt: Paulus sei nicht fromm genug. Oder wie man heute so sagt: er sei zu wenig spirituell. Ihm fehle so ein bisschen die Coolness im Auftreten. Seine Gegner sind in die Gemeinden, die er gegründet hat, eingedrungen und wollen ihre Version des Glaubens an Jesus hoffähig machen. Eine Gruppe gegen einen. Gesunde, smarte, gutaussehende und tolle Glaubensredner. Paulus dagegen schon abgekämpft und ständig leidend, was er für sich selbst aber nicht schlimm findet. Für ihn ist sein dauerhafter körperlicher Makel eine Auszeichnung. Er hat das für sich so hingekriegt, dass er sagen kann: ich trage das Leiden Christi an meinem Körper. Kurzum: wenn ihr mich seht, seht ihr durch mich hindurch Christus selbst, wie er gelitten hat. So hat Paulus die Schwäche seines Körpers zur Stärke seines Glaubens gemacht. Trotzdem blieb das seine schwache Stelle, die von anderen ins Gegenteil verkehrt wurde…Es ist die Leidenschaft für den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus, die Paulus antreibt und die ihn schafft, für die er schafft, aus der er schafft, ständig unterwegs ist, kaum noch als Zeltmacher arbeiten kann, Schiffbruch erleidet, öffentlich verspottet und mehrfach ausgepeitscht wird, wofür er alles hingibt, sein ganzes Leben…Sein Leben für Christus nennt er „diakonia“, also ein Tun für die anderen. So ist der Lehrtext von heute (1. Korinther 4,20) zu verstehen: „Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Tat (griech.: dynamis).“ Diakonie hat also Sprengkraft. Wenn du mehr zu Paulus und seinem Lebenskampf erfahren möchtest, kannst du unter der Nummer 4 unter „Predigten“ mehr dazu lesen.
11.11.24
„Wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“ (Lehrtext heute aus der Bergpredigt Jesu, Matthäus 7,8). Schön und verheißungsvoll, aber eben kein Automatismus. Deshalb ist zu fragen: Wen meint Jesus? Er meint seine Jünger. Denn um sein Wort zu verstehen, muss man den Kontext ansehen, in dem er das sagt. Seine Jünger sollen sich den Reflexen der Welt entgegenstellen: nicht richten und keine Maßstäbe an andere anlegen – den Anteil an einem Konflikt sehen und eingestehen (Olaf Scholz bei gestern bei Caren Miosga dazu nicht in der Lage) – das Heilige bewahren. Wenn ihr das macht, sagt Jesus, dann stimmen eure Beziehungen untereinander und zu Gott. Dann gibt er euch, worum ihr bittet. Dann wird euer Suchen ein Ziel haben. Dann tun sich die Herzen der Menschen auf. Seine Worte gipfeln in der Goldenen Regel: „Alles, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz (spricht: die Thora) und die Propheten.“ (7,12). Im Grunde einfach. Mache es also nicht kompliziert in deinem Innen- und Außenverhältnis und lass dir die Worte Jesu zu Herzen gehen.
10.11.24
Christus spricht: „Selig sind die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Matthäus 5,9 Wochenspruch). In seiner „Nachfolge“ legt Dietrich Bonhoeffer diesen Satz Jesu so aus: „Jesu Nachfolger sind zum Frieden berufen. Als Jesus sie rief, fanden sie ihren Frieden. Jesus ist ihr Friede. Nun sollen sie den Frieden nicht nur haben, sondern auch schaffen. Damit tun sie Verzicht auf Gewalt und Aufruhr…Das Reich Christi ist ein Reich des Friedens und die Gemeinde Christi grüßt sich mit dem Friedensgruß. Die Jünger Jesu halten Frieden, indem sie lieber selbst leiden, als dass sie einem Anderen Leid tun, sie bewahren Gemeinschaft, wo der Andere sie bricht, sie verzichten auf Selbstbehauptung und halten dem Haß und Unrecht stille. So überwinden sie Böses mit Gutem. So sind sie Stifter göttlichen Friedens mitten in der Welt des Hasses und Krieges. Nirgends aber wird ihr Friede größer sein als dort, wo sie den Bösen im Frieden begegnen und von ihnen zu leiden bereit sind. Die Friedfertigen werden mit ihrem Herrn das Kreuz tragen, denn am Kreuz wurde der Friede gemacht. Weil sie so in das Friedenswerk Christi hereingezogen sind, berufen zum Werk des Sohnes Gottes, darum werden sie selbst Söhne Gottes genannt“. (Nachfolge, Seiten 107/8, Gütersloher Verlagshaus, 4. Auflage 2013)
siehe auch die heutige Predigt zu Micha 4,1-5 auf dieser Homepage unter „Predigten“
9.11.24
Es stand dieser Tage in der BZ, dass am 9.11.1938 die Synagoge in Emmendingen nicht angezündet wurde, weil in ihrer unmittelbaren Nähe die evangelische Kirche, das evangelische Pfarrhaus und die katholische Kirche standen nebst anderen Häusern. Sie wurde stattdessen von SS-Leuten zertrümmert. Und vom Balkon des Pfarrhauses schaute das Pfarrersehepaar zu. Ich frage mich: Wie konnte man am Sonntag drauf mit gutem Gewissen einen Psalm im Gottesdienst lesen? Möglicherweise den Psalm 103: Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den Herrn, meine Seele! (103,22 Losung von heute). Sind da niemandem die Worte im Hals stecken geblieben? Hat jemand zugegeben, dass die Kirche das Recht verwirkt hat, ob dieser Zerstörung in die Melodie des jüdischen Gesangbuches, spricht die Psalmen, einzustimmen? Wie schizoid muss das gewesen sein, Weihnachten zu feiern und zu wissen, dass das Geburtstagskind ein Judenkind war und jüdische Mitbewohner weggeschafft wurden! Wie krass war das, Karfreitag zu begehen, wohlwissend, dass das einstige Kind in der Krippe der Gottessohn war – ein Jude! Lass dir nicht einreden, es gäbe ein Christentum ohne Judentum. Manche meinen sogar, das Neue Testament sei ein Kommentar zum Alten Testament. Die Zeit des naiven Christseins ist vorbei.
8.11.24
Die Frage nach der Gerechtigkeit ist für Glaubende die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Damit sind folgende Dinge ausgeschlossen:
- Alle bekommen das Gleiche
- Alle sind gleich
Gottes Gerechtigkeit gilt den Rechtlosen, den Übersehehen, den Verstummten, den Leidenden, den Unterdrückten. Das machte ER schon bei seinem Eintritt in diese Welt aus einem Dornbusch in der Steppe fest. Er versprach: „Ich bin für euch da. Ich werde für euch da sein.“ (Ex 3,14) Wer waren sie? Es waren die in Ägypten versklavten Hebräer. Er machte sie zu seinem Volk. Was harmlos klingt, hat Gefahrenpotential für Unterdrücker. Gott arrangiert sich nicht mit Ungerechtigkeit und herrschenden Machtverhältnissen. Aus seinem Mund kommen Worte der Klarheit im Blick auf die dunklen Machenschaften der Machthaber (Losung von heute Jesaja 63,1) und er gleicht aus, was Menschen in Schieflage brachten (Mt 20,15.16). Bleibe also klar, wenn es um die Frage nach Gerechtigkeit geht. Parteilichkeit ist ganz im Sinne Gottes.
7.11.2024
Das Königtum in Israel war nicht unbedingt das, was Gott wollte. Denn ER war der König seines Volkes. Schließlich gab er auf Drängen des Volkes nach. So zieht sich durch das Erste Testament eine königskritische Linie. Denn auch den Befürwortern war klar, dass ein König in Israel nicht viel anders regieren würde als die Könige seiner Nachbarn. Sie würden Steuern erheben für den Hofstaat und das Militär. Sie würden Männer einziehen für den Krieg und vieles mehr. Kurzum: einen König zu haben kann einem Volk teuer zu stehen kommen. Und schon bald nach Salomo, dem Nachfolger Davids, zerfiel das Reich in das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und in das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. In diesem befinden wir uns, wenn wir die heutige Losung aus 2. Chronik 14,10 lesen. Asa war der Nachfolger von Abija, der eigenwillig regiert hatte. Asa aber regierte so klug und gottestreu, dass er dem Land und dem Volk 10 Jahre Frieden brachte. Er musste sich kriegerisch gegen die Kuschiter durchsetzen. Deren Heer war um das Vielfache größer als sein eigenes. Bevor es zum Kampf kam und angesichts der Übermacht der Kuschiter betete Asa: „Hilf uns, Herr, unser Gott; denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas.“ (14,10) Und wer gewann? Nicht Asa. Gott schenkte ihm auch nicht einen Sieg über die Kuschiter. Es heißt: „Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, so dass sie flohen.“ (14,11) Was das bedeutet? Wenn du vor einer riesigen und übermächtigen Herausforderung stehst und Gott bittest, dir zu helfen und du stehst das durch, dann schreib das nicht auf deine Fahne. Danke deinem Gott, dass er das Blatt für dich gewendet hat.
6.11.2024
Hoffnung und Sehnsucht bleiben denen, die glauben. Die Hoffnung richtet sich auf das Gute, das kommen wird, weil Gott es so versprochen hat. Dass es im Kommen ist, nährt die Sehnsucht. Besonders in der bald kommenden Adventszeit blühen Hoffnung und Sehnsucht auf. Im Lied 107 im blauen Liederbuch klingt das „Gott kommt“ in den Strophen wie der Pulsschlag in einer schnelllebigen Welt, die meint, die Zukunft sichern zu können. Der glaubende Mensch aber ist ehrlich zu sich selbst und zeigt so der Welt, dass er selbst in dem, was sein „täglich Brot“ ist – das Beten – völlig auf Gott angewiesen ist. Das gesteht der Apostel Paulus für sich selbst ein (heutiger Lehrtext aus Römer 8). Er gibt preis, dass er nicht weiß, was er beten soll. Die Angewiesenheit auf das Wirken des Heiligen Geistes in ihm erwürgt jede Art von Stolz. Man darf als glaubender Mensch auch mal hilflos sein. Es spricht alles dafür sich einzugestehen, dass man nicht weiß, was man Gott sagen soll. Das macht nichts, denn der Glaubende weiß um den Heiligen Geist als Anwalt der Schwachen und Hilflosen. Sein Geist tritt für die ein, die leer und sprachlos sind. Wer aus welchem Grund auch immer nicht mehr beten kann, soll sich an den Heiligen Geist wenden und ihn bitten: „Mach du für mich!“
5.11.2024
Es kann einfach sein. In einer bedrohlichen Gemengelage des Staates Israel im 8. Jahrhundert vor Christus suchte der damalige König nach einer militärischen Option. Das schuf Unruhe. Und die im Moment beste Option kann sich im Nachhinein als die schlechteste erweisen. Also was machen? Es musste eine militärpolitische Entscheidung getroffen werden. Dem unruhigen Suchen und Fragen stellte der Prophet Jesaja entgegen: „Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein.“ (30.15) Diese innere Haltung setzte er dem Vertrauen in militärische Macht entgegen. Scheint sich auszuschließen. Tut es auch! Man sagt, man könne mit der Bibel keine Politik machen. Im Gegenteil! Eine Politik ohne innere Werte, wie sie Jesaja hier vorschlägt, wird Politik unüberlegt und schnelllebig. Man wünschte sich tatsächlich im „rasenden Stillstand“ (Hartmut Rosa) unserer Gesellschaft ein „Stille sein und Hoffen“, also ein Stark sein von innen heraus. Man käme dann wieder an die Frage heran: Was braucht es wirklich? Und würde damit die Frage: Was will ich haben? als fehlgeleitet entlarven. Das gilt auch im persönlichen Umfeld.
4.11.2024
„Höret, alle Völker! Merk auf, Erde und alles, was darinnen ist! Gott der Herr tritt gegen euch als Zeuge auf!“, ruft der Prophet Micha (8. Jh.v.Chr.) in die Welt hinaus. Ein nicht für möglich gehaltener Weitblick. Micha spricht nicht nur zum eigenen Volk Israel, sondern zu allen Völkern der Erde. Auch zu denen, die er nicht kennt, weil er weiß, dass die Sünden eines Volkes sich in den Untaten anderer Völker wiederholen. Micha hat kein pessimistisches, sondern ein realistisches Menschenbild. Später wird gesagt werden: die Sünde ist der Leute Verderben! Stimmt – zu jeder Zeit. Dass keiner einfach so davonkommt, hat seinen Grund darin, dass Micha an einen Gott glaubt, der die Grundlagen des Lebens geschaffen hat. Deshalb spricht Micha auch zur Erde. Dass Gott als Zeuge gegen die Völker auftritt, trifft den Ernst der Lage: die Welt ist zum Endgericht zusammengekommen. Die Klage ist erhoben. Gott wird als Zeuge geladen. Und er wird ohne Umschweife sagen, was er gesehen und gehört hat. Das wird eine Weile dauern. Die Völker sitzen ausnahmslos auf der Anklagebank. Das Urteil wird in Bälde erwartet. Ausgang ungewiss!
2.-3.11.2024
Kirchenchorprobenwochenende im Rössle in Oberprechtal. Die Andacht vom 3.11. steht unter „Predigten“ auf dieser Homepage.
1.11.2024
Verstorbene Menschen in Seelen und Heilige aufzuteilen liegt mir fern. Wer ist so vermessen zu meinen, Gott vorschreiben zu können, wer in seinen Himmel kommt? Und mit noch so vielen Messen ist noch niemand in den Himmel gemurmelt worden. Wobei ich immer mehr davon wegkomme anzunehmen, der Mensch habe eine Seele. Dieser Übersetzung liegt das hebräische Wort näfäsch zugrunde, das man besser mit „Bedürftigkeit“ übersetzt. Der Mensch als verletzliches und bedürftiges aus Erdenstaub geformtes Lebendiges. Ach ja! Aus Erdenstaub geformt überzeugt mich mehr als aus Sternenstaub gemacht. Das kann man singen, aber glauben kann man das nicht. Ich jedenfalls nicht. Die Propheten waren Gotteshörer mit Realitätssinn. Hosea wird leider viel zu wenig beachtet. Er war mit einer Hure verheiratet und hatte Kinder mit ihr, um damit dem Volk zu zeigen, dass es sich auf andere Götter einlässt, also geistlich fremdgeht. Hosea lebt diese „Abtrünnigkeit“ des Volkes existentiell. Er droht nicht mit Strafe oder Verwerfung in die Hölle. Sein schlichtes Gotteswort heißt: „Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will sich sie lieben.“ (14,5 Tageslosung) Deshalb heilen, weil fremdgehen jeder Art verwundet.
31.10.2024
Heute Reformationstag. Erinnerungen werden wach. Vor allem an das Studium, in dem mir zum ersten Mal die „Solisten“ der Reformation in aller Klarheit begegneten: sola scriptura, sola fide, sola gratia und vor allem solus Christus. Vor – Allem – die Melodien des „solus christus“ (Christus als das gelegte Fundament allen Glaubens) sollten in ihrer ganzen Fülle und Schönheit in den Herzen der Gläubigen klingen und selbstverständlich auch in der Kirche. Die Reformation einigte sich auf den Grundsatz „ecclesia reformata semper reformanda“. Ob die institutionalisierte Gegenwartskirche eine neue Reformation braucht, sei dahingestellt. Ich meine aber, eine „In-Formation“ steht auf jeden Fall an, also ein Hineingehen („In“) in den Grundbestand allen Glaubens („Form“). Dazu braucht es gar keinen Mut. Nur den Willen! Damit könnte man heute beginnen. Die Bibeltexte zum heutigen Tag nehmen uns an die Hand. Mitnehmen und führen lassen!
30.10.2024
Am Ende stand der Segen. Und das Ende war der Anfang. Mose durfte nicht in das neue Land einziehen. Damit war er eine „Interimslösung“ (sind wir nicht alle auf unseren Positionen solche Interimslösungen?). Seine beiden zentralen Aufträge waren: das in Ägypten unterdrückte Volk der Hebräer zu befreien und es durch die Wüste zu führen. Das war genug an Verantwortung. Der neue Lebensabschnitt des Volkes, die Seßhaftwerdung in Kanaan, wird einem Neuen anvertraut. An dieser Stelle steht der Segen. Im Bild gesprochen (die hebräische Sprache ist eine bildhafte, keine begriffliche): Gott wird seine Schatztruhe öffnen. Damit ist der Himmel gemeint, also der Bereich, der für Menschen nicht zugänglich ist. Gottes Segen kommt dem Volk zugute (das sollten die „Interimslösungen“ bedenken!). Er sorgt sich um das Volk auch im neuen Lebensabschnitt. Bildlich gesprochen: er wird es regnen lassen, wenn es Regen braucht. Der Regen ist Hinweis auf ein Leben im Kulturland. Ohne Regen kein Wachstum. Also für alle, die mit Sorge und Angst auf was Neues zu gehen: Gottes Segensschatz wird sich für dich auftun und der „Regen“ ist schon bestellt (so die heutige Losung aus 5. Mose 28,12).
29.10.2024
Wenn´s draufankommt, möchte ich mich voll und ganz verlassen können. Ist es wahr und daran glaube ich, dass ich von Staub der Erde gemacht bin und ich lebe, weil mich Gottes Atem am Leben erhält, dann geht das nicht anders, als dass ich mich auf ihn verlasse. Es wird mir nicht schwerfallen, mich völlig zu verlassen mit allem, was mich ausmacht, um mich seiner Barmherzigkeit und Güte (Losung von heute Psalm 22,5) zu überlassen. Das Johannesevangelium meint, das zu erkennen, sei das ewige Leben (Joh 17,3).
28.10.2024
In den Grenzlagen des Lebens verzieht sich die Harmonie. Eine davon ist das Leid. Es kommt ungefragt. Leid ist nicht ergründbar und nicht zu erklären. Wenn in der heutigen Losung (Klagelieder 1,18) steht, dass Gott gerecht ist und der Prophet Jeremia Widerstand gegen das leistet, was Gott sagt, dann spricht das nicht für Einvernehmen. Das stellt die Beziehung zu Gott auf die Probe und keineswegs in Frage. Dass das Leid nicht von Gott geschickt und er trotz allem gerecht ist, ist der Grund dafür, die Klage als alleinige Antwort auf das Leid ins Recht zu setzen. Es gilt, in der Beziehung zu Gott zu bleiben, weil er gerecht ist – will sagen: weil er auf der Seite der Leidenden ist, setzt er ihr Klagen ins Recht. Klagelieder sind seine Sache. Gott stimmt mit ein in die Klagen der Leidenden dieser Welt.
27.10.2024
Eine Stunde mehr seit gestern. Ein Geschenk zum Sonntag, das nachdenklich macht. Kann man Zeit verschieben? Nein! Nicht die Zeit, nur eine Stunde! Die Zeit ist geschaffen. Sie kam in die Welt, als Gott mit dem Licht die Finsternis zur Nacht machte und das Licht zum Tag. In diesem Rhythmus aus Abend und Morgen entstand die Zeit. Dass Gott schuf (am klarsten in der ersten Schöpfungserzählung Genesis 1,1-4a ausgedrückt, indem das Verb bará ausschließlich für Gottes Schaffen verwendet wird) setzt voraus, dass er selbst nicht geschaffen ist. Auf diesen Gott soll Israel hören. So ein Gott kann nur EINER sein, wie es in der heutigen Losung heißt. Und diesen einen Gott hat Jesus mit Abbá angesprochen.
26.10.2024
Es gibt zwei Räume, in denen man gar nicht anders als wahrhaftig und ehrlich zu sich selbst sein kann. Diese Räume sind das Selbstgespräch und das Gebet. Interessanterweise finden sich diese beiden Räume sehr schön abgebildet in der heutigen Losung aus Psalm 23. Die Verse 1-4 sind ein Selbstgespräch, das in ein Gebet mündet (5+6) und in einem Selbstvergewisserungssatz endet (V 7). Ich schlage denen, die den heutigen Eintrag lesen, eine Übung vor: Nimm dir Zeit und sage einmal „Der Herr ist mein Hirte“ und achte auf die Innenwirkung. Nach einer Zeit sagst du bewusst „Du, Gott, bist mein Hirte“ und achtest auf die Innenwirkung.
26.8.-25.10.2024
S t i l l e
2.-25.8.24
Wer diesen Eintrag lesen möchte, dem empfehle ich als Hintergrund die Lektüre meiner gestrigen Predigt in Waldkirch auf dieser Homepage unter „Predigten“.
Mit dem Doppelpack zum Fußballspiel – so möchte ich die folgenden Zeilen überschreiben. Mit Doppelpack meine ich Licht und Salz, das zu sein, Jesus (nicht nur) seinen Anhängern zugesagt hat. Das gestrige Fußballspiel in Bahlingen hatte einen Vorlauf. Kurzum: die Bahlinger sind auf die Kickers bzw. deren Vorstandschaft nicht gut zu sprechen. Deshalb wurde dieses Beispiel als Risikospiel eingestuft. Es fand am Sonntag statt, weil am Samstag bereits das Erstligaspiel zwischen Freiburg und Stuttgart als Risikospiel galt und für zwei Spiele nicht genügend Polizei zur Verfügung gestanden hätte.
Schon beim Mittagessen spürte ich dieses Kribbeln in der Bauchgegend. Ich kenne es aus der Zeit, als ich noch aktiver Fußballer war. Ich habe mich gefragt, was die Massen in die Stadien treibt. Es ist die Unsicherheit. Sie erzeugt eine ungeheure Spannung. Die Unsicherheit ist es, die das Spiel (jedes Spiel) zum Ereignis macht. Die Unsicherheit erstreckt sich darauf, wie das Spiel ausgeht: Sieg, Niederlage, Unentschieden. Weniger und mehr gibt es nicht. Die Unsicherheit über den Ausgang des Spiels macht die Magie des Spiels aus. Das wird immer so bleiben, weil niemand das Ergebnis eines Spiels vorhersagen kann – außer es wird manipuliert.
Ich fuhr mit dem Fahrrad zum Stadion. Ich stand in einer Schlange. 10 Euro Eintritt. Sehr laute Musik empfing mich. Der Lautsprecher war guter Laune. Noch. Das Spiel begann. Nach 6 Minuten lag Bahlingen mit 2 Toren im Rückstand. Nach 20 Minuten stand es 4:0 für die Kickers. Seine Fans hinter den Absperrgittern waren bester Laune. Ich sprach mit ein paar hartgesottenen Kickers-Fans. Die sind von Offenbach nach Bahlingen gefahren. Das muss man sich geben. Erzähl mir doch keiner, man könne nicht nach Teningen zu einem Gottesdienst fahren. Also! Ich weiß nicht, was es war. Spielt auch keine Rolle. Das Spiel war nach 20 Minuten gelaufen. Die Bahlinger waren ruhig und enttäuscht. Die Kickers waren froh und zufrieden. Und ich hatte meinen Doppelpack dabei. Und auf einmal war ich in Gesellschaft mit drei sehr interessanten Männern. Haben angesehene Berufe und es zu etwas gebracht. Den einen kannte ich schon. Die zwei anderen waren seine Freunde. Und es kamen die Frauen dazu. Das Gespräch zwischen uns war lebendiger und erfolgreicher als der Kick nebenan. Licht und Salz! Eine Frau erzählte mir, dass sie Kirchengemeinderätin in einer Gemeinde im Kaiserstuhl ist. Davor war sie viele Jahre Sekretärin. Für einen Mann konnte ich der aufmerksame Zuhörer sein. Probleme nimmt man auch auf den Kickplatz mit.
Licht und Salz bzw. Sein Zutrauen zu mir haben´s gerichtet! Es gab nichts zu befürchten. Bereichert, glücklich und überzeugt von der Wirkung des Doppelpacks ging ich nach Hause.
Vertrauen ist alles. Vor allem in Seine Worte!
6.7.-1.8.24
Die letzten Wochen waren geprägt vom Beenden. Das war schwer, denn ich habe mich von zwei „Leidenschaften“ getrennt: das Oboe spielen und das Unterrichten in der Schule. Das erste hat mich seit meinem 14. Lebensjahr begleitet. Vor mir hängt eine großes Foto aus dem Jahr 1974. Es zeigt ein Bläsersextett (2 Oboen, 2 Hörner, 2 Fagotte), das im Rahmen eines Schulkonzerts in der vollbesetzten Aula spielt. Ich spielte die 1. Oboe und war verantwortlich für Einsätze und Tempi. Ich war der Erste, der in St. Georgen Oboe spielte. Ich spielte sie auch im Schulorchester. Ich erinnere mich gerne an unsere Orchesterfahrten nach St. Raphael und Barcelona. So richtig in die Oboe reingefunden habe ich mich nach dem Abitur nicht mehr. Als ich jetzt wieder auf ein Konzert des Blockflötenensembles „Holzsplitter“ wieder rein finden wollte, hat mich ein Gespräch mit meinem Physiotherapeuten nachdenklich gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, nicht mehr zu spielen. Tut schon weh!
Den Religionsunterricht habe ich auch beendet. Ich habe den Unterricht immer gerne erteilt, wenngleich ich mir zu meiner aktiven Zeit mehr Zeit, Raum und Energie dafür gewünscht hätte. Ich habe alle Schularten unterrichtet: Grundschule, Realschule, Oberstufe, Hauptschule. Wäre also auch ein guter Schuldekan geworden. Aber die da Oben wollten das nicht. Selber schuld! Als ich wegen einer Vertretung angefragt wurde, habe ich erst kurz gezögert aber dann doch Ja gesagt. So habe ich einige Wochen an der Grundschule hier in Bahlingen unterrichtet. Allerdings habe ich bald gemerkt, dass mir ein längerfristiges Engagement ein Eingezwängt sein in ein zu funktionierendes „Zwang System“ nur Ärger, Unverständnis und ein großes Unbehagen bringt. Das war´s mir dann doch nicht wert. Es tat mir ehrlich leid – aber nur wegen der tollen Schülerinnen und Schüler. Die 4. Klässler, die ich zuletzt unterrichtet habe, schrieben mir eine Karte. Darauf stand: Lieber Herr Förschler! Wir konnten Ihnen ALLES erzählen. Danke!
Und auf einmal tut sich was Neues auf…
24.6.-5.7.24
Die Zeit hat es gebraucht, um nach dem Urlaub in Bahlingen anzukommen. Drei Wochen Sardinien waren prägend für Haut und Seele. Wir haben ja mitgenommen, was uns beschäftigte, konnten insularisch einiges regeln und entscheiden. Aber eben nicht alles. Zu Hause angekommen machten wir die Erfahrung: Probleme kann man durch räumlichen Abstand oft nicht lösen, aber zurück ändert sich die Einstellung zu ihnen. Unser Problem seit 2019 ist unsere Wohnung in der Burgstraße 5. Über ihr wurde – wie in allen anderen Wohnungen auch – statt einer Trittschall- eine Wärmedämmung eingebaut. Das macht das Wohnen darin fast unmöglich. Viele Jahre war die Wohnung über uns deshalb leergestanden. Letztes Jahr hat der Vermieter die Decke verstärkt und sie dann ab 1.10.23 vermietet. Seitdem leiden wir unter dem Trittschall. Dieses Problem hat uns also nach dem Urlaub wieder eingeholt. Aber wir agieren. Dazu gehörte auch dieser Brief an die Vermieter:
„Seit dem 1.10.2023 haben Sie Ihre Wohnung in der Burgstraße 5 vermietet. Seitdem ist unser tägliches Leben durch den fehlenden Trittschall durch das Lauf- und Bewegungsverhalten Ihrer Mieter stark beeinträchtigt. Stand heute ist es sogar nicht mehr zu ertragen. Es ist so weit, dass wir in unserer Wohnung dem Trittschall von oben ausweichen müssen, um einigermaßen Ruhe zu haben. Als wir kürzlich von einem Nachbar aus der Burgstraße besucht wurden, war er überrascht, wie stark er den Trittschall wahrnimmt. Er machte uns darauf aufmerksam, dass die Lampe und unser Büffet wackelten. Er meinte, dass unsere Wohnung nicht bewohnbar sei. Uns bleibt nichts anderes übrig, als in der Wohnung zurechtzukommen. Wir haben keine Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Von einem guten Freund wurden wir darauf hingewiesen, dass dieser unser jetziger Zustand einer Bestimmung des Grundgesetzes zuwiderläuft, in dem die Unverletzlichkeit der Wohnung als Persönlichkeitsrecht und das Recht, „in Ruhe gelassen zu werden.“, garantiert werden. Im Grundgesetz (Artikel 13 Absatz 1) wird also bestimmt, dass niemand in seiner Privatsphäre gestört oder beeinträchtigt werden darf. Wird dagegen verstoßen, so ist das nach dem Strafgesetzbuch als Körperverletzung zu werten. Wir haben das auch mit unseren Ärzten besprochen und sie machten uns bei weiter anhaltender Trittschallstörung auf gravierende physische und psychische Erkrankungen aufmerksam. Das sei wissenschaftlich untersucht und bewiesen.
Wir verstehen, dass Sie nach über zwei Jahren Ihre Wohnung vermieten wollten. Sie haben mit dem Mietausfall von 46.000 Euro sehr viel Geld zu erstreiten. Außerdem sind Sie bei der Deckensanierung in Ihrer Wohnung in Vorleistung getreten. Unser Anwalt hat uns davon abgeraten.
Wir haben hin- und herüberlegt, was wir tun können. Dieser Brief an Sie gehört dazu. Wir möchten, dass Sie unsere prekäre Lage kennen. Sie wollten bestimmt nicht mit uns tauschen wollen. Wir möchten Ihnen zwei Vorschläge machen.
In der Hausordnung sind die Ruhezeiten wie folgt geregelt: Mittagsruhe von 13:30 – 14:30 Uhr und Nachtruhe ab 22:00 Uhr. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre Mieter auffordern würden, während dieser Zeiten ihr Lauf- und Bewegungsaktivitäten deutlich einzuschränken. Es kann nicht sein, dass wir unsere Schlaf- und Erholungszeiten nach unseren Obermietern richten müssen.
Des Weiteren wäre es aus unserer Sicht denkbar und für die Mieter zumutbar, mit dämmenden Hausschuhen in der Wohnung unterwegs zu sein und wo nötig, Teppiche auszulegen. Zumindest so lange, bis sich für unsere Wohnung eine befriedigende Lösung gefunden hat.
Es geht uns bei unseren Vorschlägen darum, dass Sie weiter Ihre Miete bekommen und wir einigermaßen ruhig leben können. Wir wären Ihnen also sehr verbunden, wenn Sie sich unsere Vorschläge zu eigen machen könnten.
Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen.“
23.6.24
„Da schickt Gott den Nathan zu David. Beachte: Gott redet noch mit dem Sünder, er bricht den Kontakt nicht ab. Gott will David zurechtbringen, er will ihm heimleuchten, ihm vorausgehen, ihm den Weg zeigen. Nathan erzählt dem David ein Gleichnis, auf das David mit Empörung reagiert: «Dieser Kerl wird die Todesstrafe schmecken!» Man beachte: Das Rechtsempfinden des Sünders ist noch intakt. Nathan bestätigt: «Finde ich auch, nur – du bist dieser Mann!» Der Angeklagte spricht sich sein Urteil selber. Während Nathan noch nach dem Hinterausgang guckt, redet David sich nicht heraus. Sein Gewissen ist noch intakt. Nathan sagt David: «Du bist Goliath geworden. Alles, was du an Goliath verabscheut hast, bist du durch die Sünde geworden.» Die Szene endet im Gebet (Psalm 51): «Schaffe in mir, Gott, ein reines – ein ungeteiltes – Herz und gib mir einen neuen Geist, der deiner Gnade gewiss ist.» Merke: Ein Mann auf den Knien ist niemals unmännlich.“
Andreas Malessa (Anm.: Wird Schuld durch Reue gesühnt? Und wie steht es damit, dass ein König Ehebruch begeht, wo er doch Vorbild für das Volk sein sollte? Geht es um „männlich“ oder „menschlich“? Malessa teilt leider nicht mit, dass die Sünde des David eine systemische Konsequenz im Ergehen seiner Söhne hat. Demnach ist Schuld generationentoxisch – und das bleibt sie, solange Menschen sich an anderen vergehen…Ewald Förschler)
22.6.24
„Mächtig und reich geworden, liegt David gelangweilt auf dem Dach und bestellt die badende Bathseba zu sich, um mit ihr zu schlafen – obwohl sie die Ehefrau seines Feldherrn Urjia ist. Als Bathseba schwanger wird, gewährt David Urjia großzügig Heimaturlaub. Dieser aber bleibt aus Solidarität bei seinen Soldaten, was Plan B erforderlich macht: David befielt ein Himmelfahrtskommando, was unweigerlich zum Tod des gehörnten Urjia führt. Wenn die Empörung den Siedepunkt überschritten hat. Wie reagiert Gott? Soll David einfach davonkommen?“
Andreas Malessa
21.6.24
«Und es war ein Mann in Maron, der besaß ein großes Vermögen. Er hieß Nabal und seine Frau Abigail war von Verstand und schön von Angesicht.» Die Kalebiter sind beim Schafschurfest. «Als nun David hörte, dass Nabal seine Schafe schor…» Was folgt, ist eine Schutzgelderpressung in blumigen Worten. David umringen 400 bewaffnete Desperados (vgl. 1. Samuel 22). Nabals Antwort beweist, was für ein Depp er ist. Er beleidigt David grad dreifach: Wer ist David? Nie gehört! Es gibt so viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind! Da sprach David zu seinen Männern: «Gürte ein jeder sein Schwert.» Konkret: Ein Massaker liegt in der Luft. Da eilt Abigail ohne das Wissen ihres Mannes Nabal, nimmt Brote, Schafe und Wein, Feigen und Rosinenkuchen, lädt alles auf Esel und eilt David entgegen. Man beachte die Speisenfolge! Abigail präsentiert sich sozusagen als Dessert: «Achte nicht auf meinen heillosen Mann, mein Herr. Mögen deine Feinde und alle, die dir übelwollen, wie Nabal werden. Gott hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten. Und wenn Gott dir wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken.» Durch die Blume: «Um das Ableben von Nabal kümmere ich mich.» David lässt sich
überzeugen, nimmt von einem ursprünglichen Plan Abstand und unterlässt das Massaker. (1. Samuel 25)
Andreas Malessa
20.6.24
„Elisabeth Valontaire: «Ob es für einen kleinen Jungen erstrebenswert ist, ein Mann zu werden, hängt davon ab, wie er seinen Vater und Großvater körperlich erlebt hat, ob die beiden Zugang zu ihrer Gefühlswelt hatten, ob er den Papa oder den Opa mal lachend und weinend, schwitzend und erschöpft, jubelnd vor Freude oder zitternd vor Angst erleben konnte.»
Als nach langen Kriegsjahren und politischen Wirren die heiligen Gerätschaften des Tempels (Bundeslade) endlich in Davids Heimat zurückgeführt werden und sich Frieden abzeichnet, tanzt der königliche Würdenträger fröhlich durch die Straßen der Hauptstadt. Seine Frau Michal schaut im doppelten Sinn auf ihren Mann herab und sagt – männlich argumentierend –: «Wie sieht das denn aus!» David argumentiert weiblich: «Ich schäme mich meiner Freudentränen nicht.» David legt eine Unbekümmertheit und eine Bereitschaft zu Verletzlichkeit an den Tag, die in der Postmoderne kaum mehr Platz hat.“
Andreas Malessa
19.6.24
„Oft zeichnen sich Männerbeziehungen durch Konkurrenz aus. Männerfreundschaft meint eigentlich eine tiefe, ehrliche Beziehung, in der es möglich ist, über sich und seine Gefühle zu reden. David hat einen Freund: «Da schloss Jonathan David in sein Herz und gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben.» Von der Vergangenheit und Zukunft her sind die beiden komplett verschieden. Ihre Freundschaft aber hält den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen stand.“ (1. Samuel 18)
Andreas Malessa
18.6.24
„Die feindliche Armee der Philister schickt einen Riesen ins Rennen, weshalb der amtierende Feldherr Saul nie und nimmer auf den unscheinbaren David als möglichen Kämpfer gekommen wäre. David taucht nur an der Front auf, weil er seinen Brüdern etwas zu essen bringen will. Saul ist verzweifelt genug, um zu sagen: «Dann probier’s halt.» Saul denkt in männlichen Kategorien: Viel ist viel. Er staffiert den kleinen David mit Schwert, Panzerschild und Helm aus, worauf dieser sich nicht mehr bewegen kann. Während es Saul um Statussymbole geht, entscheidet sich David nicht für eine Materialschlacht, sondern für fünf Kieselsteine und einen Lederbeutel. Goliath unterschätzt den Gegner, lacht sich schlapp und sackt dann tödlich getroffen zusammen.
Was machte Goliath so hässlich und furchterregend? Was machte David so wütend? Woher bezog David seinen Kampfesmut und Siegeswillen? «Weil du Gott, den Herrn, den Hüter des Rechts, verhöhnt hast.» Die Missachtung Gottes macht David wütend.“ (1. Samuel 17)
Andreas Malessa
17.6.24
«Gott ist ein Verb: ‘Ich bin der immer mit dir sein Werdende.’»
Andreas Malessa
16.6.24
«Die Werbung mobilisiert unsere Wünsche, wer aber mobilisiert unseren Willen?»
Andreas Malessa
15.6.24
„Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.“ Wir leben in einer oberflächenfixierten Gesellschaft der Bilderflut. Nicht nur Frauen, inzwischen auch Männer bekommen je nach Aussehen bei Bewerbungsgesprächen mehr oder weniger Einstiegsgehalt angeboten. Männer über 1.80 und unter 75 kg haben beim Vorstellungsgespräch von vornherein bessere Chancen. Faktisch aber entsprechen 90% der Menschen nicht den gängigen Schönheitsidealen. In der Bibel läuft es anders. Dazu ein Beispiel aus 1. Samuel 16.
Der Prophet Samuel sucht als Headhunter für die Thronfolge Isai auf, der daraufhin seine Söhne aufmarschieren lässt. Samuel fragt Isai: «Hast du noch andere Söhne?» Worauf dieser antwortet: „Ja – einer ist noch bei den Schafen. Er heißt David.“ Was zeichnet David aus? Fürsorge und Betreuung Schutzbefohlener ist ihm wichtig. Eigenschaften eines Hirten: Fürsorglich, sanft, vorausschauend, zäh, mutig, umsichtig, verantwortungsvoll, fach- und sachkundig. Ein Hirte kalkuliert die zu wandernden Wegzeiten anhand der Kapazität seiner schwächsten Schafe. Ein Hirte muss seine Autorität nicht mit Imponiergehabe beanspruchen, weil er eine Autorität ist. Wer eine Autorität ist, muss nicht autoritär sein. Die Herde bewegt sich, wenn der Hirte vorausgeht. Der Hirte muss also wissen, wo er hinwill, und er muss tatsächlich verlässlich vorangehen. David wird von den Schafen weggeholt und von Samuel zum künftigen König von Israel gesalbt (d.h. nominiert).
Andreas Malessa (red. Ewald Förschler)
14.6.24
«Paulus hat für uns Jesus auf Europäisch übersetzt.»
Andreas Malessa
13.6.24
«Gottes Wort in Menschen Mund ist Teil seines Abstieges und seines Sich-uns-verständlich-Machens.»
Andreas Malessa
12.6.24
«Die Menschen im antiken Orient verstanden sich von der Sippe her: Ihre einzige Hoffnung war ein Weiterleben in den Weiterlebenden. Kinderlosigkeit kam damals einem Gestorben sein zu Lebzeiten gleich.»
Andreas Malessa
11.6.24
«Die Sünde entfremdet mich von mir, macht mich zu dem, der ich nie werden wollte.»
Andreas Malessa
10.6.24
«Der erste im Neuen Testament, der die Bibel wörtlich nimmt, ist der Teufel.» vgl. Matthäus 4
Andreas Malessa
9.6.24
«Nicht Kriegsflüchtlinge plündern die Staatskasse, sondern Steuerflüchtlinge.»
Andreas Malessa
8.6.24
«Ich will der Bibel vertrauen, weil sie meinen inneren Dialog mit dem Auferstandenen stimuliert und von Christus her ausgelegt wird.»
Andreas Malessa
7.6.24
«Die Bibel überzeugt nicht mit Argumenten, sondern mit Geschichten, die uns zu einem Vertrauensschritt animieren. Die Bibel kalibriert unseren inneren Kompass.»
Andreas Malessa
6.6.24
Wortraumschätze
- Ich möchte nicht verzichten auf die Idee, dass diese Welt einen Ursprung hat. Einen Schöpfer, der uns ins Leben geliebt hat und mit dieser Schöpfung zum Ziel kommt. Aus Liebe wurden wir geboren. Liebe ist unsere Mutter.
- Ich will die Zukunft nicht ohne diese Hoffnung denken und ich werde mich nicht auf das Diesseits vertrösten lassen. Gott wird unsere Tränen trocknen.
- Ich bin zuhause im Christentum. Ein Haus, das wohnlich ist für mich; in das ich gerne einlade, auch wenn ich mich nicht in allen Zimmern gleich wohl fühle. Es ist für mich eine Art Villa Kunterbunt. Die Kleinen finden Platz. Wunder sind möglich. Es gibt eine Schatztruhe voller Goldstücke. Das ist mal ein schönes Bild für Gnade. Und es gibt dieses lindkrineske Urvertrauen: die Mama im Himmel ist immer da! Es gibt auch Tommies und Annikas. Willkommen! Es gibt auch Polizisten und Brüselise. Auch willkommen! Und es gibt die heilige Geistkraft. Und die hat manchmal rote Zöpfe.
- Die große Erzählung von Jesus, dem Christus, gibt meinem Leben den Rhythmus. Ich feiere im Advent die Schönheit des Wartens. 24 Türchen zu öffnen in einer Welt, die so oft Türen zuschlägt. Ich liebe das Geheimnis von Weihnachten: das Heilige in der Mitte dieser Welt. Ja sogar die Jungfrauengeburt. Was für eine Entlastung! Wir schaffen uns nicht allein! Dass Jesus weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein; dass er diese Welt kennt mit ihren vielen irritierenden Erfahrungen. Die Hingabe, das Widerständige, seine Empathie; dass er einseitig war, so ein Grenzgänger; präsent für die Armen und die Außenseiter; dass ich seinetwegen bei reich nicht zuerst an Geld denke, sondern an eine Gemeinschaft der Würde; dass er nicht über diese Erde stolziert ist, sondern sich tief in unser Leben eingegraben hat; ich teile die Überzeugung seiner Passion: freiwillig übernommenes Leiden hat verändernde Kraft. Ich schätze so sehr, dass das Christentum von seinem Wesen her nicht nur auf Glück aus ist; dass es weiß: kein Leben ist unverletzt. Es gibt kein Leben ohne Tragik, ohne Brüche, ohne „Warum, mein Gott?“, ohne Abgründe und Leiden. Und gerade darin zeigt sich Gottes Zuwendung. Eine gleichgültige Glücksreligion würde mich persönlich gar nicht interessieren. Oder anders gesagt: Ich würde ihr nicht trauen. Wer wäre ich ohne Ostern? Auferweckungsenergie. Diese gründliche Unterbrechung. Ich will nicht auf den 7. Tag verzichten. Jeder Sonntag erinnert mich wieder und wieder daran: die Liebe ist stärker als der Tod. Zu glauben, Gott zu vertrauen fasziniert und beseelt mich mehr als hoffen könnte. Gottesvertrauen ist für mich die Gegenbewegung zum Zynismus und ein Schutz vor Selbstüberschätzung. Und noch mal. Ich bin ausgesprochen verliebt in die Idee der Gnade. Das Recht, ein anderer Mensch zu werden. Voraussetzungslose neue Chance.
- Ich bin sehr gerne Protestantin. Ich schätze die Mündigkeit und die Beteiligung, keinen Papst zu haben, sondern eine Anna Nicole oder Gremien und Umfragen. Oder wie es Dorothee Sölle sagt: „Evangelisch sein heißt, keinen Papst zu haben, sondern ein Buch.“ Ja, die Bibel. Diese großartige Erzählerin ist älter und weit weiser als wir. Diese durchgebeteten Worte. Dieses Buch, das die Natur Schöpfung nennt. Wir leben im Geliehenen. Ihre klare Entscheidung für die Armen; dass sie uns an unsere Wurzel erinnert. Ja, wir werden von einer Wurzel getragen. Wie wunderschön sie Wünsche äußert, die Bibel. Diese leise Stimme, die flüstert „Liebt unbedingt!“ Ich berge mich im Größeren. Ich brauche auch einen anderen Geist, weil der Zeitgeist mir so gerne seine Botschaft diktieren will. Abendmahl hilft mir, in dieser Welt auf Wandlung zu hoffen und zeigt mir, dass wir teilen können. Im Beten übe ich freie Meinungsäußerung, eine Sprache ohne Lüge und Zensur. Und jetzt sind wir am Ende des Kirchenjahres und ich freue mich über das Buch des Lebens. Es gibt einen Ort für unsere Toten. In Gott sind alle Lebensgeschichten bewahrt und werden bis ins Happy End erzählt. Ich bin gerne die Schwester von Jesus, dem Christus. Ich habe mich angefreundet damit, seinen Namen zu tragen – Christina. Er ist der charmante Komplize unserer Hoffnung.
So weit mal meine Liebeserklärung mit einigen Wortschätzen unserer Erzählgemeinschaft. Morgen ist Astrid Lindgrens Geburtstag. Die neueste Biographie über sie hat den Titel „Eine wie sie fehlt in dieser Zeit“. Ohne Kirche fehlt mir etwas. Mit Kirche fehlt mir erst recht etwas. Das ist das Schönste, was ich über Kirche sagen kann: In der Kirche wird meine Sehnsucht größer. In der Kirche wächst meine Hoffnung. Sie wird dort gefüttert. Morgen ist auch in 40 Tagen Weihnachten. 40 Tage ist in vielen spirituellen Traditionen eine besondere Zeitspanne. Auch so ein Schatz. Aber ich hatte nur 20 Minuten. Und die sind jetzt um. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
5.6.24
Erzählraum-Erfahrung 2 – Warum in der Kirche sein?
Ich teile noch eine Erfahrung. Es war eine Lesung mit Navid Kermani. Er las aus einem Buch, in dem ein Vater Abend für Abend seiner Tochter erzählt von seiner eigenen und dann überhaupt von Gott, von der Liebe, vom Tod, von Zweifeln, vom Beten und von Moral, von Spenden und Verzichten und vom Schutz der Schöpfung. Und dann sagte er: „Bei der Religion muss es doch auch noch um etwas anderes gehen als um Moral. Nicht nur darum, gute Menschen zu sein. Religion soll wohl heute die richtige Meinung vertreten. Aber darauf, dass man Flüchtlingen hilft, kann man schon selber kommen. Dazu braucht man keine Religion. Es steht in den heiligen Texten. Nur bei Religion geht es nicht nur um das, was uns der gesunde Menschenverstand sowieso sagt.“ Dann kam aus dem Publikum eine Frage: „Braucht es für den Glauben eine Gemeinde?“ Kann man sich ja fragen. Und Kermani antwortete: „Nun! Es braucht mindestens eine Sprache.“ – „Allerspätestens bei einer Beerdigung merken wir, wie verloren wir wären, wenn wir keine Worte hätten; wenn wir nicht eingeübt hätten, wie wir unsere Toten begraben. Sollen wir uns das selbst ausdenken? Ist es nicht gut, dass hunderte Jahre Menschheit uns Worte, Gesten und Symbole hinterließen?“ Ich zitiere noch einen Wortfreund, Fulbert Steffensky. Er sagt: „Es könnte sein, dass wir als Kirche, um der Gesellschaft einzuleuchten, nur noch das erzählen, was ihr sowieso einleuchtet. Die Gefahr ist, dass wir bei den Sagbarkeiten bleiben aus eigener Glaubensschwäche. Dass wir uns darauf beschränken, das aus der Bibel herauszulesen, was man mit menschlicher Stimme sagen kann: ein bisschen Moral und ein bisschen Menschlichkeit. Moral und Menschlichkeit sind viel. Aber die Bibel ist das Buch, das Gott und Christus nennt.“ Ich persönlich sage das so: Mitglied in einer Partei bin ich, weil ich das vernünftig finde, weil wir Moral und Menschlichkeit brauchen. Mitglied in der evangelischen Kirche bin ich, weil ich Kraft brauche für Moral und Menschlichkeit. Mitglied in einer Partei bin ich geworden angesichts der großen Krisen unserer Zeit – vor allem wegen der Sorge um das Klima und um die offene Gesellschaft. Mitglied in der evangelischen Kirche bin ich geblieben, weil ich in den großen Krisen Kraft brauche, die über mich hinausgeht. Ich brauche mehr, als ich beweisen kann und selber leisten, etwas ganz anderes: Gott, die Ewige, die Treue, Güte ohne Ende. Ich brauche Zeit, von einer anderen Welt zu träumen. Hoffnung, Zuversicht und eine Gemeinschaft, die diese Schätze erinnert und feiert, weil es Dinge gibt, die wir nicht sehen, die aber ändern, wie wir die Dinge sehen.
Und daher teile ich noch eine paar Glaubenssätze mit Ihnen. Ein paar Wortschätze. Es ist eine Art Liebeserklärung.
4.6.24
Hinter dem Ofen ist kein guter Ort
Verehrte, engagierte Geschwister! Menschenskinder! Zeigen wir, was wir haben. Ja, mit Respekt, mit Neugier, mit Toleranz. Aber bitte, liebe Kirche! Teile deine Wortschätze! Unsere Schätze – teilen wir sie! Die Schönheit unseres Gottvertrauens, die großen Grundsätze und die Bilder dieser Hoffnung und Haltungen, die Geschichten, die dazugehören: weiße Taube, weiß wie Schnee, Regenbogen, Sterne, Wind, ein Kind, Wolf und Lamm gemeinsam, Esel und Eselinnen auch, Brunnen, Brot, Lilien, lange Tafeln mit Gästen aus allen Himmelsrichtungen, Schwerter, die zum Pflug werden. Caroline Emke nennt die biblischen Texte so schön „ein Kernreservoir“. Ich sage gerne Urgut.
3.6.24
Arten der Sprachlosigkeit
Manchmal sind wir sprachlos. Das ist in dieser Welt angemessen. Es gibt diese feine Sorte „Sprachlosigkeit“, die erst mal mitweint und direkt rät oder erklärt oder Gott verteidigt. Es gibt aber auch eine „Sprachlosigkeit“, die mit Scham oder Scheu zu tun hat. „Ich kann mich zu innersten Haltungen nicht äußern. Ich will nicht sichtbar werden.“
Es gibt auch eine Sprachlosigkeit, die mit Leere zu tun hat. Es ist einfach nichts da. Und da wird bei einer Idee wie der Jungfrauengeburt müde gelächelt („Das ist ja so eine peinliche Idee: Geboren von der Jungfrau Maria!“). Weil der Schatz hinter dieser Idee nicht erobert wurde: dass wir uns nicht uns selbst verdanken; dass das Leben immer ein Wunder ist; dass ich zu meinem Gottvertrauen gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind. Wir nennen das Gnade. Und das ist auch echt ein altes Wort und wirklich nicht leicht verständlich, auch wenn es sehr evangelisch ist. Es wie Gott, ein Fremdwort, das übersetzt werden will. Gnade ist schwer zu verstehen und gleichzeitig kennen so viele das Gegenteil in unserer so gnadenlosen Zeit, die Gnade so dringend braucht: Solidarität, Wohlwollen, Gütekraft, bedingungslose Empathie. Gnade für die Schule beim Mobbing, für die lange Schlange bei der Tafel, fürs Regieren, für die Politik, umgeben von Einschaltquoten und Hochrechnungen. Und für euch, hohe Synode, für eure großen Themen. Gnade. Unsere Welt braucht diese Kraft. Unsere säkulare Gesellschaft braucht eine Kirche, die noch von dieser anderen Kraft weiß – und von ihr erzählt. Unsere Zeit mit ihren unsäglichen Nachrichten will doch wissen, was hält uns und unser Zusammenleben. Woher kommen die Ideen und die Kraft, sie auch zu leben? Ja – woher nehmen, wenn nicht lesen? Die Weisungen der Bibel jedenfalls bieten Ideen – gemeinsam mit anderen großen Texten.
2.6.24
Freiheit des Sprechens
So! Aber niemand muss erzählen. Alle sind eingeladen ans Lagerfeuer. Niemand muss predigen oder öffentlich sprechen, Rechenschaft ablegen von seinem Glauben. Ich höre immer wieder, dass es schwerfällt, über das eigene Vertrauen zu sprechen, Gott vertrauen. Die gute Nachricht ist: Wir sind nicht gezwungen. Wir dürfen uns äußern. Es ist ein Recht. Es ist ein Privileg. Es ist nicht selbstverständlich weltweit gesehen. Es gibt hier kein Redeverbot, auch wenn das immer wieder mal behauptet wird. Widerspruch ist erlaubt und sogar erwünscht und wird gebraucht. Die Demokratie braucht Worte. Menschen brauchen Worte. Und die Worte brauchen Freiheit: Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit – und sie sind alle da!
1.6.24
Geschenkte Gewissheit
Und ich glaube, das ist ein Geschenk, das die Christenheit, die Kirche unserer Zeit machen kann, dass da Raum ist mitten in den vielen Krisen, einen Moment still zu sein als Suchende, das Müssen zu lassen, das „Ich weiß, wie´s geht!“, zu erzählen, zu fragen, zu teilen, zu klagen, auch die Trauer gutzuheißen um vertane Jahre und verpasste Chancen, zuzugeben auch, dass wir manchmal ohnmächtig fühlen, dass wir ratlos sind. Die Kirche könnte für eine Erlaubnis einstehen: Wir sind verletzlich! Wir sind sprachlos! Wir sind überfordert! Verletzlich wie unsere Erde, wie unsere Demokratie, wie unsere Vorfahren und unsere Kinder, wie Jesus verletzlich war und verwundet und gerade da zeigte sich Gott. Da wurde Ostern ein Wunder für die Wunden. Das ist eine Kirche, die ich lieben kann: eine Anlaufstelle, ein Kraftort, wo Platz ist für Gespräch, ein Erzählraum mit gedeckten Tischen, ein Netzwerk für Initiativen vor Ort, ein Netzwerk, ansprechbar und – ja! – sie spricht auch von Hoffnung, von Auferweckungsenergie, von Unterbrechung. Ich erlebe eine Scheu vor Gewissheiten. Ein Misstrauen gegenüber Autoritäten. Ich erlebe auch eine Sehnsucht nach Verbundenheit, Gemeinschaft wie ein Lagerfeuer. Was nicht erzählt wird, trennt. Doch wenn ein Ich erzählt, ein Mensch sich traut und seine Sicht beim Namen nennt und ein anderer merkt, dass er das kennt – das ist ein heiliger Moment – das Lagerfeuer brennt. Und damit wir nicht nur unser Echo hören, müssen auch die erzählen, die uns stören. In unseren Erzählraum mischte sich immer wieder diese andere Stimme ein. Sie kam z.B. aus Psalmen, aus uralten Erzählungen, die von Hoffnung wussten, von Trotz und Trost, von einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Sie inspirierte unser Hören und begleitete es. Auch der letzte Kirchentag wurde mit einem großen Lagerfeuer verglichen. Ich erinnere mich gerne an diese Tage. Wenn der Rechtsruck dieser Tage unsere Kehle zuschnürt, erinnere ich mich: da gibt es eine evangelische Bewegung und im Rücken eine große Institution, die sich nicht Rechtsaußen einschmeichelt, die klar dasteht gegen das Eklig sein, für das Menschlich sein.
31.5.24
Erzählraum-Erfahrung 1 – Reden ist Gold!
Ich erlaube mir, eine Erfahrung zu teilen. In der Zeit, als wir in der Pandemie nicht live Gottesdienst feiern konnten, hat meine Gemeinde gesagt: Wir brauchen jetzt Erzählräume. Wir müssen einander zuhören. Und die Gemeinde wurde ein Treffpunkt für Geschichten. Wie wir die Pandemie erlebt haben als Singles, als Alleinerziehende, WGs, als Familien, mit kleinen oder schulpflichtigen oder großen Kindern, als Krankenschwester, Freiberufler, Lehrer, Therapeut, Journalistin, als Großeltern. Wir hörten lauter Beispiele, die wir nicht kannten. Wir erzählten, was wir vermisst hatten: das Singen, eine angemessene Beerdigung. Auch was uns geschenkt wurde: das Summen, eine Lesung aus Indien, Entdeckungen, dass die Schwester gut Haare schneiden kann und wie lieb die Natur uns half, beweglich zu bleiben. Wir hörten Sätze wie: Mich hat seit Monaten niemand umarmt. Und: Ich habe so viel mehr von meiner Familie mitbekommen. Die Kinder erzählten und die Jugendlichen von dem, was nicht nachgeholt werden kann: Klassenfahrten, Abiball. Zitat: „Ich habe echt die Schule vermisst.“ Und: „Corona würd´ich gern verkloppen!“. Wir hörten auch Geschichten von weiter weg. Die Pfarrerin der Partnergemeinde von Norditalien musste so viele Menschen beerdigen. In Indien fehlte Sauerstoff. Diese Erzählräume zu haben war wundervoll. In alten Mauern, in umbeteten Raum entstand aus Zuhören Zugehörigkeit.
30.5.24
Worte der Hoffnung
Menschen brauchen Worte. Und von Zeit zu Zeit sollten sie hören, sollten wir hören. Weg vom Trubel, in der Stille des Herzens etwa, am Morgen mit Blick in den Himmel erinnern: Wir sind nicht allein. Sollten wir hören: Fürchte dich nicht! Friede sei mit dir! Das verleiht einem beginnenden Tag ein graziöses Vorzeichen.
29.5.24
Das Sprechen braucht das Hören
Menschen brauchen Worte. Und die Worte brauchen das Hören. Und das Hören braucht Aufmerksamkeit. Ich persönlich habe noch nie Gottes Stimme vernommen. Und ich frage mich, was ich eigentlich höre, wo ich weghöre, wer mein Ohr haben darf, wem ich vielleicht – Gott bewahre! – gehorche. Der Prophet Elia hört etwas – Gott!? – wie das Rauschen eines leisen Wehens. Um das wahrzunehmen brauchte es Stille. Ich finde, das ist eine schöne Spur. Im Hebräischen haben Wüste=midba und das Wort dabar und sprechen medabar dieselbe Wortwurzel. Für mich heißt das: im Lärm und im Getöse und allen Nachrichten hört das Vertrauen noch eine andere Stimme. In der Wüste des eigenen Herzens hört es die alten Worte des Vertrauens. Ja! Wer hat uns etwas zu sagen? Wer darf uns etwas sagen? Unsere Lieben natürlich. Die Kinder hoffentlich. Die Erde hoffentlich. Und in dem allem, darunter und darüber ist eine Stimme, die noch etwas anderes weiß, überliefert in der Bibel, die der Hoffnung immer wieder das Wort gibt.
28.5.24
In den folgenden Tagen möchte ich eine Rede von Christina Brudereck wiedergeben, die sie auf der Herbsttagung der EKD 2023 zum Thema „Wortschätze teilen“ gehalten hat. Hier der erste Teil:
Vom Sinn der Worte
Menschen brauchen Worte. Und die Worte brauchen die Menschen. Menschen wollen sprechen und angesprochen werden. Ich wusste gar nicht so recht, wie ich Sie ansprechen soll. Menschenskinder hätte ich am liebsten gesagt…Das Christentum ist nicht zu denken ohne das Wort. Es ist eine verbale Kultur. Ausgesprochen verbal sind wir Evangelischen, die Sola-Scriptura-Leute. Mit sind mit unserer Wurzel, dem Judentum, eine Erzählgemeinschaft. Es ist da zu lesen: Mit Worten schuf Gott die Welt, rief sie ins Leben. Worte schaffen etwas. Unsere Sprache kann schön sein, sogar Liebe erklären. Sie kann hässlich sein, Hass und Gewalt auslösen, beschweren und verletzen. Sie kann missverständlich sein und unverständlich. Die Sprache des Glaubens, wie über Gott gesprochen wird, kann unpassend sein, irrelevant, weltfremd, belanglos. Sie kann phrasig sein und peinlich. Was noch einmal etwas anderes ist, als dass es uns peinlich ist, über unser Gottvertrauen zu sprechen, etwas über Gott zu sagen. Ich verstehe das. Vertrauen ist persönlich, will gerne dezent sein, sich in sicherem Rahmen äußern. Gleichzeitig finde ich es wenn nicht schlimm, so doch ausgesprochen schade, wenn wir nicht von Gottvertrauen sprechen. Ich bin überzeugt, dass es die Sprache des Glaubens braucht. Dass unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie sie brauchen – die Worte, die Bilder unseres Gottvertrauens. Unser Auftrag ist es, für andere dazu sein und von Gott zu erzählen. Ja, der Glaube zeigt sich „in der Tat“. In der liebevollen Tat zeigt sich Gott ganz klar. Nicht nur in Predigt, Andacht, Feier. Es braucht auch praktisch Nächstenliebe. Denn Worte sind ja gut, aber Hühner legen Eier. Aber auch das: wenn wir nicht erzählen, entsteht ein Vakuum. Und irgendwer wird es füllen mit anderen Worten, Werten und Bildern. Und das macht mir inzwischen richtig Angst. Und ich finde es doch nicht nur schade. Ich finde es schlimm, wenn wir nicht erzählen. Es heißt aber nun: der Glaube kommt aus der Predigt. Das schreibt Paulus in einem Brief an die Gemeinde in Rom. Anders ausgedrückt: Gottvertrauen erwächst aus dem Hören auf die Verkündigung. Gottvertrauen beginnt mit dem Hören, mit Aufmerksamkeit. Schema Israel! Höre Israel! heißt es im berühmtesten jüdischen Gebet. Es heißt nicht: Sprich Israel! Es heißt auch nicht: Tu etwas! Nicht zuerst. Und das Schema wird täglich gebetet. Oft sind es die letzten Worte, die ein Mensch jüdischen Glaubens flüstert.
27.5.24
Sie hat mich beeindruckt. Schon vor dem Gottesdienst in Gundelfingen reagierte sie auf die Begrüßung von mir, einer Kirchenältesten und der Kirchendienerin mit den Worten: „So liebe Menschen hier!“ Sie nahm vorne Platz. Nach dem Abendmahl saß sie gerührt in der Bank und weinte. Nach dem Gottesdienst kam sie auf mich zu und bedankte sich dafür, dass ich den Predigttext Epheser 1,3-14 ausgelegt habe. „Wissen Sie! Ich lese jeden Morgen die Losungen. Und am Sonntag lese ich den Predigttext. Dann bin ich vorbereitet auf die Predigt. Ich bin immer so enttäuscht, wenn ein anderer Bibeltext ausgelegt wird.“ Sie ist 91 Jahre alt. Und die Kirche ist gerettet, wenn die Predigenden sich den Bibeltexten stellen würden, die gegeben sind.
26.5.24
Ich war in Gundelfingen und war dort verantwortlich für einen Gottesdienst mit Abendmahl. Ich habe in der zurückliegenden Woche lange mit mir gekämpft, ob ich den vorgeschriebenen Predigttext Epheser 1,3-14 nehmen soll oder nicht. Ich weiß nicht, aus welchem Grund ich es nicht tat. Gewohnheit? Pflichtbewusstsein? Wirken des Geistes?
25.5.24
Wer bin ich als Pensionär? Einer sagte mir mal, als die Pension anstand: Bald bist du Privatier! Fast hätte ich es geglaubt. Gekommen ist es anders. Hätte es auch anders kommen können?
24.5.24
Es ist ein Zwiespalt, in dem ich stecke. Wenn ich einen Gottesdienst besuche – wer bin ich dann? Hörer, Pfarrer, Analyst, Kollege, Mensch..? Was mache ich mit meinen Gefühlen, wenn ich vor einem Impuls stehe, dass ich am liebsten den Kirchenraum verlassen möchte, weil ich das, was da vorne geschieht, nicht mehr ertragen kann?
23.5.24
Mit dem Kind sein verbunden ist vor allem die Tatsache, dass etwas mit Kindern geschieht. Sie werden gezeugt, geboren, erzogen, gewickelt, gefüttert, getragen, geschlagen, angezogen, erzogen, geführt, verführt, missbraucht…Und dann geschah das hier:
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
Es sind Erwachsene, die die Kinder bringen. Spielt aber keine Rolle. Die Kinder werden nicht näher klassifiziert. Es sind Kinder. Es sind Menschen. In der Antike waren Kinder keine Menschen. Hier schon. Dass Jesus sie berühren soll deutet darauf hin, dass die 1-3 Jahre alten Kinder krank waren. Nur um einen Segen zu empfangen hätte sich die Mühe nicht gelohnt, sie zu Jesus zu bringen. Segnen konnte auch ein Priester. Und dann geschieht etwas. Die, mit denen immer etwas gemacht wurde, laufen auf Jesus zu. Die Jünger Jesu herrschten aber die Kinder an. Da platzte Jesus der Kragen und er stellte seine Jünger in den Senkel. „Lasst sie zu mir kommen!“, heißt dann auch, dieses kleine Wunder zu bestaunen, dass die Kinder eigeninitiativ geworden sind. Ihnen gehört das Reich Gottes, also die Welt, die Jesus gepredigt hat. Allen Kindern dieser Erde gehört die Welt Gottes. Ausnahmslos alle Kinder dieser Erde sind Eigentümer des Reiches Gottes. Und jetzt sollen die Erwachsenen mal beweisen, wie sie da hineinkommen mit ihrem Stolz, ihrem Imponiergehabe und ihren unseligen Diskussionen, Bewertungen und Urteilen. Sie müssten sich nämlich von den Eigentümern des Reiches Gottes beschenken lassen und ihnen danke sagen – den Kindern! Und dann heilt Jesus die Wunden, die die Erwachsenen den Kindern schon zugefügt haben.
Vom 2.-22.5.24 hat sich das Tagebuch ausgeruht
01.05.24
Ich habe gestern Brot gekauft. Gegenüber der Bäckerei liegt die italienische Eisdiele. Und schon winkten mir ein paar Viertklässlerinnen. Sie genossen das Eis. Die eine erzählte mir, sie habe Mango am liebsten, der anderen sah man schon an der Bräunung der Mundwinkel an, dass sie Schokolade bevorzugte. Wir flachsten herum. Bis mir das Schokomädchen erzählte, sie freue sich auf den kommenden Sonntag. Sie habe da ihren 10. Geburtstag. „Stell dir vor: 5.5.24. Und nächstes Jahr habe ich am 5.5.25 den 11. Geburtstag.“ – „Wow!“, sagte ich und stellte ihr und den beiden anderen eine Rechenaufgabe: „Wie alt bist du, wenn du am 5.5.55 Geburtstag hast?“ Die Drei schauten mich mit offenen Mündern an. „41.“ – „Richtig!“, erwiderte ich. Und mir fiel ein, dass so eine Zukunftsschau was ganz anderes ist als die Unterweltsszenarien, mit denen man Tag für Tag konfrontiert wird.
30.4.24
Nach dem Autopilot und der Effektivität kommt das Mehr auf der Stufe des Selbstgewahrseins. Fragte die Effektivität noch danach, wie wir mehr von unseren Wünschen verwirklichen können. geht es beim Selbstgewahrsein um die Fragen: „Was wollen wir wirklich?“ – „Was wünschen wir uns eigentlich?“ – „Wohin sind wir unterwegs?“
29.4.24
Es muss mehr geben. Und es gibt mehr. Kerstin suchte nach diesem Mehr. Sie war eine Schönheit. Ich habe sie auf einer Freizeit kennengelernt. Sie war Teilnehmende und ich Betreuer. Es gibt ein Bild, auf dem wir beide mit anderen zu sehen sind. Es wäre was aus uns geworden, wenn nicht so ein Schlaule von Oberbetreuer den belehrenden Satz hätte fallen lassen: „Zwischen Betreuer und Teilnehmer darf nichts passieren!“ Ich habe noch einen Brief von ihr, in dem sie verzweifelt von ihren schulischen Problemen erzählt. Sie wohnte nicht weg von mir. Wir hätten uns treffen können. Doch es kam nicht dazu.
28.4.24
Der Himmel singt und klingt – Sonntag Kantate…(Predigt zu Offenbarung 15,2-4 unter „Predigten“)
27.4.24
Es muss mehr geben. Der Mensch ist ein Suchender.
- Sucht er an der falschen Stelle…
- Bekommt er die falschen Antworten auf seine guten Fragen…
- Nimmt er seine Unzufriedenheit nicht ernst…
- Tut er sein Suchen mit „Nichtigkeit“ ab…
- etc.
…dann wird der Suchende zum Süchtigen. Die Angebotspalette ist groß, zumal in einer überfütterten Gesellschaft wie unserer. Man sagt, dass am Bahlinger Baggersee Drogen gekauft werden können. Ich trauere heute noch um Kerstin. Sie erstickte in schulischen Problemen. Als ich sie nach Jahren besuchen wollte, öffnete die Mutter. Als ich sie nach Kerstin fragte, starrte sie mich mit großen Augen an und sagte: „Kerstin ist an einer Oberdosis Heroin gestorben.“ Drehte sich um und schlug die Tür zu…
26.4.24
Nur so machen und weitermachen wie bisher. Wird über kurz oder lang öde. Das Leben erschöpft sich im Immergleichen. Hebt man es auf die Stufe der Effektivität, wird es dem Nützlichen unterworfen. Wie sollen sich in dieser Zwangsjacke sensible Werte entwickeln und entfalten können? Wie Liebe, Freundschaft, Zärtlichkeit? Die können doch nur auf der Strecke bleiben.
25.4.24
Nach der Oberfläche bzw. dem oberflächlichen Leben kommt die Effektivität. Hier beginnt das Fragen: Trägt unser Handeln das ein, was wir wollen? Das Tun des Lebens wird „in Frage gestellt“. Dieses Frage ist die nach der Effektivität des Tuns und damit des Optimierungsdenkens. Das „Immer so“ hat ausgedient. Das 21. Jahrhundert hat die Effektivität zum Mythos erklärt. Doch wird das reichen? Muss es nicht mehr geben?
24.4.24
Autopilot ist die Oberflächenschicht des Lebens. Hier fragen die Menschen nicht, warum sie tun, was sie tun. Sie machen es einfach. Der Großteil des Lebens geschieht reflexhaft, weil über das eigene Tun nicht nachgedacht wird. Sokrates nennt das ein „Leben ohne Selbsterforschung“. Solch ein Leben sei es nicht wert, gelebt zu werden.
23.4.24
Wie geht es Menschen, die im Modus des Autopiloten sind? Die ein frag-loses Leben führen und deren Lebensmaxime lautet: Wir tun, was wir tun, weil wir das immer so machen.?
22.4.24
Man sollte mal Marcel Proust lesen („Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“). 4000 Seiten in 6 Bänden. Weltliteratur. Erst hat er gelebt, dann geschrieben. Die Erzählung über „Madeleine“ war Thema bei unserem „Literarischen Menu“ am Samstagabend. Ein vielschichtiger Text, der einiges in sich hat. Mir hat es Lust bereitet, in diesen Text hineinzusteigen. Das hat mich am meisten fasziniert: Proust spricht vom „Ende der Menschen und der Dinge“. Eigentlich müsste dann alles weg sein. Doch für ihn halten „Geschmack“ und „Geruch“ als personalisierte Seelen das Gebäude der Erinnerung wach. Das ist für mich ein Hinweis auf ein „sinnvolles Leben“, also ein Leben mit allen uns gegebenen Sinnen. Sie sind Gaben des Unsichtbaren und verweisen damit auf die Ewigkeit.
21.4.24
Sonntag Jubilate (siehe Psalm 66) und ich habe trauernde Angehörige vor mir! Das ist immer richtig schwierig und anstrengend. Ich bin dann trotzdem bei meiner Predigt geblieben (siehe unter „Predigten“).
20.4.24
Eine so noch nicht dagewesene Todesanzeige vom 19.4.24 lautet wie folgt: DAS LETZTE SPIEL KENNT KEIN UNENTSCHIEDEN…Platzverweis für Markus Koch! Fassungslos bleiben am Spielfeldrand zurück…
Ist das Leben ein Spiel? Wie weit sind Vergleiche aus dem Reich des Fußballs hilfreich für die Bewältigung eines Abschieds? Siehe auch den Beitrag vom 8.2.2024!
19.4.24
Die Selbstbestimmung pflegt die Frage: „Was wollen wir wirklich?“ Die meisten Menschen kommen erst gar nicht in die Nähe dieser Frage, weil sich ihr Leben zwischen Alltag und Effizienz ihres Tuns zerreibt. Und ein zweiwöchiger Urlaub ist zu kurz, um diese Frage in ihrer Tiefe und Weite zu erfassen. „Was will ich wirklich?“ Die Frage zielt also auf das Mehr des Wollens und damit zielt sie auf die Elemente des Lebens, die die elementare Bedürfnisbefriedigung übersteigen. Sie fragt nach dem Sinn des Lebens als eine Frage des modernen Menschen. Doch ich frage mich: Wie kann ich herausfinden, was ich wirklich will? Im Wort „Selbstbestimmung“ steckt das Wort „Stimme“. Warum nur sind wir so stumm, wenn es darum geht herauszufinden, was wir wirklich wollen? Wo ist unsere Stimme? Was wollen wir aussprechen? Wann wollen wir sagen, was uns wichtig ist? Wie stehe ich zu meiner Stimme? Wann gebe ich dem, was ich wirklich will, eine Stimme? Welches ist mein Wort aus mir heraus?
18.4.24
Es gibt zwei Bereiche, die das Leben betreffen. Den Bereich „Aktion“ und „Reflexion“. Diese beiden Bereiche haben wiederum zwei Ebenen. Die „Aktion“ hat die Ebenen „Autopilot“ und „Effektivität“. Die „Reflexion“ hat die Ebenen „Selbstgewahrsein“ und „Selbsttranszendenz“. Die Selbstbestimmung ordne ich der Ebene „Selbstgewahrsein“ zu und damit der Frage: Was wollen wir wirklich? Diese Frage bei sich zu tragen ist ungemein wichtig. Denn sie schützt vor Übergriffen und macht diese bewusst. Es ist jedem Menschen zu wünschen, dass er diese Bewusstseinsebene erreicht. Doch da gibt es noch eine höhere Ebene im Bereich „Reflexion“. Davon morgen!
17.4.24
Abtreibung bestrafen? Homosexualität bestrafen? Warum eigentlich? Woher kommt Strafe? Strafe ist die Reaktion eines Systems auf eine Systemvergehen. Jedes System wird von moralischen Werten bestimmt, die in der Regel religiös begründet werden. Jedes System braucht Werte, sonst endet es in der Anarchie. Wenn jetzt die Straffreiheit für Abtreibung gefordert wird, stellt sich dieselbe Frage. Woher kommt diese Forderung? Was hat sich im System geändert, dass sie nicht mehr bestraft werden soll? Es hat sich ein Wert verschoben von der religiösen Moral zur psychologischen Werteskala. Und dort steht die Selbstbestimmung ganz oben. Die kann nicht bestraft werden. Sie verlangt nach Straffreiheit, weil nicht bestraft werden kann, was die Selbstbestimmung will. Doch wie weit kann und darf Selbstbestimmung gehen? Ist sie der neue, alles regelnde moralische Wert? Und was ihr nicht entspricht wird in Zukunft bestraft?
16.4.24
Wüstenzeit ist Versuchungszeit. Die Evangelisten wollen mit der Versuchungsgeschichte in der Wüste zeigen, wie sattelfest man sein muss, um da gut durch- und rauszukommen. Es geht also um die Basis des Glaubens. Die Antworten Jesu auf die Angebotspalette des Versuchers stammen allesamt aus dem 5. Buch Mose, also der Thora. Der Grundstein für das Gewachsensein in Extremsituationen wird in der Kindheit gelegt. Hören, Lernen, Wissen, Gewissheit, Bewusstsein, Selbstbewusstein, Gottesbewusstsein sind die Reifungsstationen.
15.4.24
„Und führe uns nicht in Versuchung.“ Kürzer geht´s nicht. Es ist die letzte Bitte, die Jesus den Jüngern für ihr Gebetsleben mitgibt. Die Bitte ist genauso gemeint. Wer meint, sie müsse abgewandelt werden, damit sie passt, vergeht sich an ihr. Es gibt nämlich Leute, die meinen, Jesus hätte die Bitte so gemeint: und führe uns in der Versuchung. Das ist völlig daneben. Wer soll denn in eine Versuchungssituation führen? Und wenn ich schwach werde, soll´s Gott dann mal wieder richten? So läuft das leider nicht. Die Bitte Jesu ist nicht an den „üblichen“ Gott gerichtet, sondern an seinen Abbá=Papa. Und das zum ersten Mal in der Geschichte Israels. Jesus kannte die klassischen Versuchsgeschichten der jüdischen Bibel (Abraham und Hiob) und wusste um die Zerbrechlichkeit des Glaubens. Sein Gott aber, sein Abbá, soll uns vor solch einer Situation bewahren. Denn dem Gott Jesu fehlt jede Anwandlung von Zynismus.
14.4.24
Es gibt zwei Räume, in denen der Mensch sich nicht belügen kann oder muss. Das ist das Selbstgespräch und das Gebet. Selten findet sich beides in einem. Doch im Psalm 23, der am heutigen Sonntag Misericordias Domini im Mittelpunkt steht, ist es so. Der Psalmbeter beginnt mit den Worten: „Der Herr ist mein Hirte…“ Und plötzlich wechselt er in: „Du bist bei mir…“ Am Ende wechselt er dann weiter in: „Gutes und Barmherzigkeit…“ Man könnte also den Psalm 23 als Paradebeispiel nehmen für den fließenden Übergang von Selbstgespräch in Gebet und von Gebet zurück ins Selbstgespräch. Beide brauchen sich. Beides sind Räume der Ehrlichkeit.
13.4.24
WorthausPlus gestern in Bahlingen zum Thema „Schuld macht Gefühle“. Welche Gefühle sind das? Scham, Wut, Verstecken, Depression, Selbstabwertung. Schuld macht klein. Jesus ordnet das Thema „Schuld“ systemisch ein. Er lässt dem stets schuldig werdenden Menschen seine Würde, indem er ihn vor Gott „Kind“ sein lässt. Er legt ihm die Bitte „Vergib“ ans Herzen. Dadurch muss kein Mensch an seiner Schuld zerbrechen, weil er die aller Schuld vorausgehenden Liebe Gottes zu ihm erkennt und in ihr leben darf. Sodann ist der so in der Vergebung Gottes geborgene Mensch selbst auf seine Weise „Gott“, indem er fähig wird, anderen zu vergeben. Und das heißt in erster Linie: sich frei machen von Gefühlen wie Wut, Rache, Vergeltung und chronische Vorwürfe. Der vergebende Mensch ist der frei (gewordene) Mensch. Im Unterschied zum Versöhnen geschieht das Vergeben im Inneren ohne das entsprechende Gegenüber. Das Vergeben lernen ist ein Selbstbefreiungsakt. So gesehen hatte Jesus mit der Bitte im Vaterunser „Vergib uns unserer Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ die seelische Gesundheit der Menschheit im Blick.
12.4.24
Josef hat Jesus den „barmherzigen“ Gott weitergegeben. Er hat ihn gelehrt, ihn Abbá=Papa zu nennen. Und das zum ersten Mal in der Gebetsgeschichte Israels ohne „Beiwerk“ wie „Lieber“ oder „in den Himmeln“ o.ä. So hat es Jesus seinen Jüngern weitergegeben in seinem Gebet, als sie ihn fragten, wie und was sie beten sollen. Es ist ein Gebet für die Menschheit. Wegweisend ist es für das Beten insofern, als es die Rollen klärt zwischen Abbá und den Betenden. Abbá ist der zärtlich-liebende Gott und die Betenden sind seine „Kinder“. Daraus ergibt sich, dass nach Jesus das Beten der „Kinder Gottes“ allein im Bitten besteht. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu: „Nicht die allgemeine Anbetung, sondern das Bitten ist das Wesen des christlichen Gebets.“ (Nachfolge, S. 159).
11.4.24
Urvertrauen und Selbstvertrauen gehören zusammen. Jesus hatte beides. Auf diesem Hintergrund ist zu verstehen, wenn er „Ich bin“ sagt (die 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium) oder auch die sog. Antithesen in der Bergpredigt des Matthäusevangeliums („Ich aber sage euch!“). Etwas muss passiert sein. Das ist wohl an seiner Taufe durch Johannes festzumachen. Da hörte Jesus die Stimme Gottes, seines Vaters=Abbá=Papa, die zu ihm sagte: „Du bist mein geliebter Sohn. Du gefällst mir.“ Dieser Einbruch des Himmels in sein Leben ist der Durchbruch zu einem Selbstbewusstsein, das ihn ausgezeichnet und getragen hat (transzendent als Gottesbewusstsein=Ich bin angenommen!).
10.4.24
Die Gegend am See Genezareth beschreibt Josephus wie folgt: „Entlang dem See Genezareth erstreckt sich eine gleichnamige Landschaft von wunderbarer Natur und Schönheit. Wegen der Fettigkeit des Bodens gestattet sie jede Art von Pflanzenwuchs, und ihre Bewohner haben daher in der Tat alles angebaut; das ausgeglichene Klima passt auch für die verschiedenartigsten Gewächse. Nussbäume, Palmen, Feigen- und Olivenbäume…Der Boden bringt nicht nur das verschiedenste Obst hervor, sondern er sorgt auch lange Zeit für reife Früchte. Die königlichen unter ihnen, Weintrauben und Feigen, beschert er zehn Monate lang ununterbrochen, die übrigen Früchte reifen nach und nach das ganze Jahr hindurch. Denn abgesehen von der milden Witterung, trägt zur Fruchtbarkeit dieser Gegend auch die Bewässerung durch seine sehr kräftige Quelle bei…“ (Jüdischer Krieg III,10.8).
9.4.24
Über die Zeit vor seinem öffentlichem Wirken ist nichts von Jesus bekannt. Es sind die Jahre der Vorbereitung, in denen er Erfahrungen mit Menschen und mit Gott gesammelt und ausgewertet hat, Jahre des Lernens und Kennenlernens. Er war mit seinem Vater, dem „teknon“=Mann vom Bau, in Galiläa, auf der via maris und in der fruchtbaren Gegend um den See Genezareth unterwegs. Hier, in Kapernaum, wird Jesus seine zweite Heimat finden. Er hat diesen Ort und diese Gegend bewusst gewählt. Er hatte auch andere Möglichkeiten. Betanien etwa, wo seine Freundinnen Marta und Maria und sein Freund Lazarus lebten. Er geht auch nicht ins Gebirge. Er geht nach Kapernaum.
8.4.24
Wo war Jesus geistlich beheimatet? In den Teilen des Jesajabuches, die im babylonischen Exil entstanden sind, also ab Kapitel 40 (Deuterojesaja 40-55 und Tritojesaja 56-66). Dieses sog. „Trostbuch“ des Deuterojesaja (40-55) beginnt mit den Worten: Tröstet, tröstet mein Volk. Er hielt daran fest gerade angesichts römischer Besatzung, des Terrorregimes des Pilatus und jüdischer Kollaborateure (Zöllner).
7.4.24
Durch das Edikt des Perserkönig Kyros, der die Babylonier besiegte und in Jesaja 45,1 „Messias“ genannt wird, war es den deportierten Juden erlaubt, nach Israel zurückzukehren. Das taten bei weitem nicht alle. Es blieb eine einflussreiche Gruppe von Juden in Babylon, die in intensivem Kontakt mit den Ausgewanderten stand. Mitte des 2. Jh. kehrten diese babylonischen Juden nach Israel zurück und siedelten sich in Galiläa und im heutigen Golan an. Nazareth wird als eine Gründung dieser endzeitlich gestimmten jüdischen Siedler aus Babylon angesehen. Und Jesus wuchs in Nazareth auf.
6.4.24
Die Eltern wurden früher als „Stellvertreter Gottes auf Erden“ bezeichnet. Das stimmte. Je nachdem wie die Eltern waren, wurde auch das Gottesbild geprägt. Jesus hatte eine Mutter, die im apokalyptischen Milieu verwurzelt war. Deshalb auch die Taufe durch Johannes. Sein Vater war eine torafrommer Jude, der eine weite, menschenfreundliche Auslegung der Tora praktizierte. Er war es, der Jesus den „Abbá“, den liebenden Vater lehrte, wie er in Hosea 11,1.4 und Jesaja 63,15f. überliefert ist. Wenn ein Mensch aus diesen verschiedenen Strömungen seinen eigenen Glauben gestaltet, ist das ein Zeichen persönlicher Reife. Das verweist auf den morgigen Sonntag. Es geht um Thomas und die Gemeinschaft der Glaubenden (Johannes 20).
5.4.24
Es muss was passiert sein. Die Absprache zwischen Johannes und Jesus war die: Johannes verkündigt das Zorngericht Gottes. Wenn dieses gekommen ist, wird Jesus das Gnadenjahr verkünden. Doch von dieser Reihenfolge hat sich Jesus verabschiedet. Er sprach von Gott und seiner Gnade ohne dass der Mensch für deren Empfangen eine Bedingung erfüllen musste. Jesus muss noch eine andere Schule besucht haben, in der er auf die Linie Hosea-Jesaja gestoßen war, während Johannes die Linie der Gerichtspropheten Amos-Jeremia vertrat. Der Unterschied zwischen Johannes und Jesus lag also in deren Gottesbild, das sie durch das Studium der Thora und Propheten gewonnen haben. Jesus selber hatte großen Respekt vor seinem Lehrer Johannes. „Er ist es, von dem es geschrieben steht: Ich sende meinen Boten vor dir her, damit er den Weg vor dir bereitet.“ , sagte er von ihm (Lukas 7,27).
4.4.24
Gerichtsrede – Gottes Zorntag – Umkehr zur Buße: das waren die Themen, die Jesus bei Johannes gelernt hat. Doch hat er sich davon abgewendet und seine eigene Auslegung der Thora gefunden. Jesu Botschaft war ein Trostwort, kein Drohwort. Jesus ging gewöhnlich in seine Synagoge in Nazareth. Ein Dorf mit ca. 300 Einwohnern und einem kleinen Bethäuschen, das die Synagoge war. Dort ging er eines Tages hinein und legte ein Wort aus dem Propheten Jesaja (61,1.2) aus. Lukas beschreibt die Begebenheit wie folgt: „Er öffnete die Thora und fand die Stelle, wo geschrieben stand: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen in Freiheit zu entlassen, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn.“ (Lk 4,17-19) Daraufhin legte Jesus die Thora beiseite und sagte: „Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.“ (Lk 4,21) Dieses Gnadenjahr gab es in der Thora tatsächlich. In Leviticus 25,8ff. heißt es: „Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen; es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippen kommen…“ Jesus kannte die Thora und hat die darin erkennbare Gnadenlinie in Worten und Taten ausgelegt.
3.4.24
Was hat Jesus bei Johannes, seinem Verwandten gelernt? Im Nazaräerevangelium (140 n.Chr. in gewisser Nähe zum Evangelium nach Matthäus) heißt es im Fragment 5: Seine Mutter und seine Brüder sagten zu Jesus: „Johannes der Täufer tauft zur Vergebung der Sünden. Wir wollen hingehen und uns von ihm taufen lassen.“ Jesus erwiderte: „Was habe ich gesündigt, dass ich hingehe und mich von ihm taufen lassen soll? Aber vielleicht rede ich aus Ungewissheit und so habe ich gesündigt, ohne es zu wissen.“ Ganze Familien hat es zu Johannes gezogen, um sich von ihm die Taufe zur Vergebung spenden zu lassen. Im Umkreis des Johannes erfuhr Jesus von der Revolution Gottes, dem Umsturz, der totalen Veränderung der Welt, die bald komme und dass es für Israel noch eine Rettung gibt, sofern die Weisungen Gottes eingehalten werden. Jesus begegnet bei seiner Taufe den Jüngern des Johannes und freundet sich mit ihnen an. Johannes selbst war nicht so von Jesus überzeugt. Noch aus dem Gefängnis lässt er fragen: „Bist du, auf den wir gewartet haben? Oder sollen wir auf einen anderen warten?“ (Lukas 7,18ff.). Trotzdem scheint Johannes Jesus als seinen Nachfolger angesehen zu haben. Er sagte von ihm: „Es kommt aber einer, der ist größer als ich…“ (Lukas 3,16). Nach dem gewaltsamen Tod des Johannes gehen seine Jünger mit Jesus.
2.4.24
Johannes der Täufer ein Mitglied von Qumran?
Qumran steht für eine Bewegung, die sich als heilige und reine Gemeinde verstand. Ihr Zentrum war das Kloster am Toten Meer. Sie hatte aber auch Sympathisanten und Mitglieder in ganz Israel – östlich des Jordan bis nach Damaskus. Ihre Wurzel lag in den 30er Jahren des 2. Jh. v.Chr. Damals war eine Gruppen von Frommen unter dem „Lehrer der Gerechtigkeit“, einem Priester, aus Jerusalem und dem Tempel ausgezogen, weil sie als unrein angesehen wurden. Der Tempel war nicht mehr der Tempel, wie er sein sollte. Die Thora wurde nicht mehr praktiziert. Der amtierende Hohepriester wurde als „Frevelpriester“ bezeichnet. Die „Aussteiger“ von Qumran waren entschiedene Leute. Sie hatten ein hohes religiöses Ethos. Sie versuchten, die Weisungen der Thora radikal zu leben. Sie glaubten, dass Gott bald kommen und den Mächtigen auf der Erde ein Ende bereiten würde. 200 Jahre lang haben sie auf das Kommen Gottes gewartet und hatten sich im Erleben der „Verzögerung“ eingerichtet. Qumran wurde von den Römern zerstört. Johannes teilt mit Qumran die Vorstellung von der Nähe des Kommen Gottes und den Glauben, dass nur eine radikale Umkehr die Rettung vor dem Gericht bringen könne. Da er keine Ehelosigkeit und andere asketische Übungen forderte, eröffnete er dem ganzen Volk die Möglichkeit der Umkehr.
1.4.24
Auferweckung – was bedeutet sie?
Ohne das Zeugnis, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wäre das Kreuz Jesu ein Monument des Scheiterns geblieben, das Beispiel eines sinnlosen Todes, eines von vielen, in denen sich den Schein des Rechts gebende Barbarei der Macht triumphierte. Das Bekenntnis, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag gemäß der Schriften (1. Korinther 15,4) lässt auch das Ereignis in einem neuen Licht erscheinen, von dem aus dieser dritte Tag gezählt wird. Im grauenhaften Geschehen seines Todes am Kreuz wird wahrgenommen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften (1. Korinther 15,3)…Sünde ist hiernach Herrschaft von Menschen über Menschen, ist Unterdrückung und Gewalt. Sünde ist es, dem Wunsch, Erster und Großer zu sein, in der Weise von Herrschaftserlangung und Herrschaftsausübung nachzugehen. Vergebung erweist sich dann als Befreiung aus den Verstrickungen in die Gewaltgeschichte, als Befreiung aus der Komplizenschaft mit der Macht der Gewalt. Solche Befreiung erblickt die Gemeinde in der völligen Ohnmacht des Todes Jesu.“ (Klaus Wengst, Ostern. Ein wirkliches Gleichnis, eine wahre Geschichte / Kaiser Taschenbücher / S. 59+64)
31.3.24
Ostersonntag – Auferweckung – Auferstehung – Himmelfahrt?
Man muss die beiden Begriffe „Auferweckung“ und „Auferstehung“ klären, um zu verstehen, was an Ostern gefeiert wird. Im Glaubensbekenntnis heißt es: gekreuzigt – gestorben – begraben. Von Beginn an wird das Leben Jesu passiv ausgedrückt. Sein erstes aktives Tun wird mit „hinabgestiegen“ beschrieben. Das heißt, dass der tote Jesus im Grab „aufgeweckt“ wurde. Denn um etwas tun zu können, muss man lebendig sein. Fortan wird das Leben Jesu mit aktiven Verben beschrieben: hinabgestiegen, auferstanden, aufgefahren, sitzen, wiederkommen, richten. Sein Auferstehen halt also die Auferweckung als Voraussetzung. Insofern feiern wir an Ostern zwei Ereignisse: die Auferweckung Jesu von den Toten durch seinen „Abbá“ und sein „Auferstehen“ aus dem Bereich des Todes. Das war seine Entscheidung. So gesehen feiern wir an Ostern nicht nur zwei Ereignisse, sondern auch zwei Entscheidungen: das Auferweckung Jesu durch Gott und das Auferstehen Jesu von den Toten, bei denen er ja war.
Der Auferstehung muss nicht konsequent die Himmelfahrt folgen. Denn das Evangelium nach Matthäus verzichtet auf eine Erzählung von der Himmelfahrt. Stattdessen endet es mit den Worten des Auferstandenen: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit.“ Damit geht Matthäus davon aus, dass der Auferstandene in der Gemeinde lebendig ist. Und das ist auch logisch: Denn wenn der Auferstandene verspricht „Ich bin bei euch alle Tage“, dann kann er nicht weggehen. Und die Himmelfahrt ist ein Weggehen. Im Übrigen ist der „Immanuel“, der „Gott-mit-uns“, der Gott, der sich Mose im Dornbusch mit den Worten offenbart hat: „Ich bin für euch da. Ich werde für euch da sein.“ (Exodus 3,14). Ein Gott, der sein Sein an das Verbunden sein bindet.
30.3.24
Karsamstag – Zwischenzeit und diskursive Gedanken zu einem „heißen“ Thema
Ein Zwischenzeit macht was mit einem. Man hängt durch. Man weiß nicht weiter und fragt sich: War´s das jetzt? Zurück zum Alten. Neues gibt es nicht. Und doch beginnt in diesem Zwischenraum zwischen Trauma und Ungewissheit, zwischen Wut und Depression eine Kraft zu arbeiten. Es ist die Kraft des Verarbeitens. Aus dem Trauma wird ein Traum und aus der Wut wird ein Lebensentwurf. Die Kreuzigung ist historisch datierbar auf den 7./8. April 30 n.Chr. Die Auferstehung ist nicht datierbar. Sie ist eine Vision. Der einzige Satz, der sie „beweisen“ kann, ist der von Menschen, die sagen: „Wir haben den Herrn gesehen.“ Allerdings sagt das nur einer von sich und das ist der Apostel Paulus (1. Korinther 15,8). Von den anderen wird es nur berichtet, dass sie den Herrn gesehen haben. Dass die Auferstehung nicht wie die Kreuzigung auf einen bestimmten Tag datiert werden kann, lässt sich mit einer Stelle aus dem Propheten Hosea belegen. Dort heißt es: „Gott macht lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden.“ (6,2). Die Zeitangabe „Tag“ ist hier nicht kalendarisch zu verstehen. Sie soll sagen, dass Gott in der vergehenden Zeit zu seinem selbstgewählten Zeitpunkt die Toten aufrichten wird. Die Auferweckung/Auferstehung ist nicht von dieser Welt. Hätte es eine Kamera in Jesu Grab gegeben – man hätte den Vorgang der Auferweckung/Auferstehung nicht filmen können. Der Film wäre leer gewesen.
Noch was. Jedes Jahr flammt die Diskussion auf, ob das strenge Gesetz zum Schutz des Karfreitags noch zeitgemäß sei. Durch die zunehmenden Kirchenaustritte nimmt die Diskussion an Schärfe und offenbar auch an Plausibilität zu. Ich meine, dass es Zeit wird, dass die Kirchen zu Potte kommen und einen Pflock einschlagen sollten.
Vorschlag: Jedes Kirchenmitglied bekommt einen Mitgliedsausweis. Dieser Ausweis berechtigt das Mitglied, die christlichen Feiertage zu begehen und begründet damit den bisherigen „Urlaub“ an diesen Tagen. Diejenigen, die das Gesetz aufweichen oder abschaffen wollen, sollen für ihre Einstellung einstehen und auch die Konsequenzen tragen und arbeiten gehen. Es macht ja keinen Sinn, gegen etwas zu wettern und dann noch davon zu profitieren. Die Kirchen sollten also mit der Mitgliedschaft ernst machen. Und die, die nicht mehr in der Kirche sind (keiner, der in der Kirche ist, will, dass die Feiertage ausgehöhlt oder abgeschafft werden), sollen auch nicht mehr von den Gütern der Kirche wie Freizeit an deren Feiertagen teilhaben. Wenn also ein Kirchenaustritt nur Profit für die Austretenden bedeutet, hinkt was. Die Kirchen sollten schauen, dass das für sie ins Gleichgewicht kommt und damit der Gesellschaft signalisieren: „Wir haben verstanden. Wir sind nicht mehr die Volkskirchen. Wir sind jetzt die Kirchen im Volk. Und das setzen wir jetzt um.“
29.3.24
Karfreitag – „ibis ad crucem!“ („Du gehst ans Kreuz!“) – der gefürchtetste Satz in der Antike.
Nach dem Urteilsspruch wurde die Kreuzigung sofort öffentlich vollstreckt. Der Verurteilte wurde an die Folterer übergeben. Er wurde ausgepeitscht mit Peitschen, in deren Lederstreifen Holz- und Knochenstücke eingearbeitet waren. Die Zahl der Peitschenhiebe war nicht begrenzt. Nach der „Geißelung“ war der Körper nur noch eine einzige offene Wunde. Viele Verurteilte sind schon durch die Geißelung gestorben. Ein sensibler Folterknecht hörte rechtzeitig auf. Dann wurde der Verurteilte dem Hinrichtungskommando (1 Offizier, der die Tafel mit dem Urteil vorneweg trug, und vier Soldaten) übergeben, das ihn durch die Straßen der Stadt trieb. Der Hingerichtete musste den Querbalken tragen. Man nutzte gezielt Umwege, um die Schaulistigen abzuschrecken. Die Kreuzigung wurde immer außerhalb der Stadt, aber in der Nähe des Stadttors, vollstreckt, um zu zeigen, dass der Gekreuzigte aus der Gesellschaft der Menschen ausgeschlossen ist. Und auch wegen des Verwesungsgeruchs, denn ein Gekreuzigter wurde nicht bestattet. Das war deshalb schlimm, weil die Menschen glaubten, dass jemand, der nicht bestattet wird, keine Ruhe findet. Auf dem Hinrichtungsplatz waren die senkrechten Balken bereits aufgerichtet und der Verurteilte wurde daran an Seilen hochgezogen. Dann wurden die Füße an den Balken gefesselt oder genagelt. Was folgte, war eine völlige Machtlosigkeit: ein Gekreuzigter konnte sich nicht kratzen. Er konnte sich nicht vor Schmerzen krümmen. Er konnte die Fliegen nicht vertreiben, die in den Wunden sitzen. Der Sitzpflock auf der Mitte des senkrechten Balkens erleichterte ein mühsames Aufrichten und verhinderte zugleich das Zusammensacken und war somit ein sadistisches Wechselspiel, das sich ständig wiederholte. Die Gelenke im Oberarm kugelten aus. Der Körper wurde starr und das Gesicht entstellte sich. So wurden die Gekreuzigten öffentlich zur Schau gestellt. Und so mussten sie ihre Notdurft verrichten. Der Tod trat durch Ersticken, Verdursten oder durch die Schmerzen ein. Die Leichen wurden von wilden Tieren angefressen. Ein Gekreuzigter konnte sich nicht zum Sterben hinlegen. Die Mutter Erde war zu schade für ihn. Ein Gekreuzigter starb heimatlos in der Luft.
28.3.24
Gründonnerstag
Der Tag hat nichts mit der Farbe „grün“ zu tun. Der Name dieses Tages leitet sich ab vom mittelhochdeutschen Wort „greinen“ und bedeutet so viel wie „klagen“ und „weinen“. Je nachdem, wie man das sehen will. Wie isst man mit Freunden, wenn man weiß, dass es das letzte Ma(h)l ist? Aus nachösterlicher Perspektive ist es das letzte Essen Jesu mit seinen Freunden. Ein Abschiedsessen. Was nachösterlich einer logischen Abfolge von Gründonnerstag – Karfreitag – Auferweckung/Auferstehung entspricht, muss vorösterlich eher einer Befürchtung entsprechen und damit verbunden auch eine stille Hoffnung enthalten, dass Jesus den Tod nicht erleiden muss. Die Frage „Musste Jesus sterben?“ ist eine nachösterliche Frage und will den Sinn dieses bestialischen Kreuzestodes ergründen. Die Heilige Schrift hat dafür eine Vielzahl von Deutungen. Ich nehme die, die bei mir am meisten Resonanz erzeugt. In dieser Deutung wird das Krepieren Jesu draußen auf der Schädelstätte (Golgota ist hebräisch und meint „Schädel“, weil der Hinrichtungsort die Form eines Schädels hatte) mit dem Tempelkult in Jerusalem verbunden. Sie geht so:
Auf der Erde hat Jesus den Verbrechertod erlitten. Aber im Himmel hat das eine andere Bedeutung. Vor den Toren Jerusalem musste Jesus sterben, während in der Stadt im Tempel Gottesdienst gefeiert wurde. Doch der wahre Gottesdienst findet nicht im Tempel statt, sondern draußen auf Golgota. Das ist ein himmlischer Gottesdienst und der, der vor der Stadt stirbt, ist der wahre Hohepriester. Denn er vereinigt in sich alle Opfer und ist das einzige und wahre Opfer. Er bringt sich selber dar. In Jerusalem gab es viele Opfer und viele Priester. Im Himmel gibt es nur ein Opfer und einen Hohepriester und das ist Jesus. (Hebräerbrief).
Wobei es auch mal Sinn macht, sich dem Opferbegriff zuzuwenden. Dabei hilft die dreifache Bedeutung des „Opfers“ im Englischen weiter:
- Victim: passiv – zum Opfer geworden (Verkehrsunfall, Gewalttat) – wie bei Jesus: er war Opfer verschiedener Interessen (Pilatus und der Hohe Rat) – er war ein Opfer von Gewalt und von Sünde
- Sacrifice: eine Gottheit besänftigen durch ein Opfer – nicht bei Jesus! Stimmt mit Jesu Gottesbild nicht überein.
- Offering: Hingabe, Geben, Weggeben (Zeit, Kraft, eigenes Leben für andere, ein höheres Gut) – wie bei Jesus! Hingabeformeln: Jesus gibt sich selbst, er wird nicht geschlachtet (pro Existenz – für andere); sein Tod ist Teil seines Lebens; er wäre nie so gestorben, wenn er nicht so gelebt hätte…
27.3.24
Dass der Priester Zacharias zweifelte, als ihm der Engel Gabriel die Geburt seines Sohnes Johannes ankündigte, brachte ihm ein mehrtägiges Verstummen ein. Das gehört zum apokalyptischen Szenario. Ihm ist also nicht die Spucke weggeblieben. Er war auch nicht einfach sprachlos. Sein Verstummen war die Folge seines Unglaubens. Als Priester müsste er wissen, dass bei Gott nichts unmöglich ist (1. Mose 18,14). Sein Sohn Johannes („Gott ist gnädig“) macht eine apokalyptisch-endzeitliche Karriere. Er lebte asketisch (kein Wein oder andere berauschende Getränke – auch kein Cannabis). Sein Gewand war aus Kamelhaaren und er hatte einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Er aß getrocknete Heuschrecken und wilden Honig. Er kritisierte die Lebensweise des Herodes. Das kostete ihm den Kopf (Markusevangelium Kapitel 6,14-29).
26.3.24
Es kann keinem Menschen unterstellt werden, er wolle nicht auf seine Weise ethisch verantwortlich leben. Nur klappt das nicht bei jedem und dann landet er im Gefängnis oder wird bestraft. Nimmt man aber mal diese „Gesetzesverstöße“ weg, dann kann man den Menschen abnehmen, dass sie sich um ein Mindestmaß an Anstand bemühen. Anstand klingt altmodisch. Ich habe aber nichts gegen anständige Menschen. Sie wissen, was im Bezug auf den anderen „ansteht“. Sie sind sozialsensibel. Die Moral der Religionen und Kirchen überfordert die Menschen. Wer kann schon von sich behaupten, die 10 Gebote einzuhalten? Oder den Erleuchtungsweg des Buddha vollumfänglich zu gehen? Oder gibt es den perfekten Christen, Juden, Moslem? Oder gar den perfekten Atheisten oder Nihilisten? Es bleibt den Menschen deshalb nur, sich der aufgestellten Moral zu unterwerfen, also unterwürfig zu werden oder sich von ihr zu distanzieren. Johannes der Täufer wusste das und hat deshalb einen menschlichen Raum geöffnet. Statt die Menschen der Hölle und dem Untergang preiszugeben, hat er ihnen die Umkehr geschenkt. Sinnbild der Umkehr war die Taufe.
25.3.24
Johannes, der Täufer hatte eine handfeste Moral, die keinen überfordert hat. Beispiele: „Wer was doppelt hat, gebe dem, der nichts hat.“ (Adressat: Reicher) / „Fordere nicht mehr, als festgesetzt ist.“ (Adressat: Zöllner) / „Begehe gegen niemand eine Gewalttat und Erpressung. Seid zufrieden mit eurem Sold.“ (Adressanten: Soldaten). Wie würde Johannes heute reden – zu Politikern, Pfarrern, Richtern, Bürgermeistern, Lehrern? Ausgenommen die Kinder natürlich!
24.3.24
Palmsonntag. Um in der Tiefe zu verstehen, was heute abgeht, muss man sich frei machen vom Gedanken der logischen Abfolge. Es liegt dem Geschehen dieser (Kar)Woche kein Plan zugrunde. Nichts, was geschieht, ist logisch oder konsequent. Wenn es so wäre, dann könnten wir uns vom Geheimnis dieser Woche verabschieden. Machen wir uns ehrlich! Dann verstehen wir die überschwängliche Freude, die am heutigen Tag einst ausbrach. Als Jesus mit seinen Anhängern in Jerusalem einzog, um wirklich werden zu lassen, was er auf seiner Wanderschaft wie ein Mantra predigte: Das Reich Gottes kommt! Gott wird uns von den Römern befreien! Endlich! Begeben wir uns hinein in die Dynamik dieses Tages, dann heißt das für uns: Nichts weniger als dass endlich Gerechtigkeit in diese Welt einzieht ist Grund einer großen Freude. Palmsonntag heißt: Niemals die Hoffnung auf das Kommen Gottes aufgeben oder anders: Sein Ankommen begeistert feiern!
23.3.24
Jesus traf Johannes in „Betanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.“ Das ist nicht mit dem Betanien südlich von Jerusalem zu verwechseln. Das Betanien des Johannes meint ein ganzes Gebiet, nämlich Batanea, das im Bereich des südlichen Golan im Norden Israels liegt. Johannes ist gewandert: von Norden nach Süden, um alle Israeliten mit seiner Umkehrbotschaft zu erreichen. Von „Dan bis Beerscheba“ (1. Samuel 3,20) war das Gebiet der 12 Stämme Israels. So wie Johannes ist Jesus dann auch gewandert. Er hatte auch Jünger bei sich, unter anderen waren das die Fischer Petrus und Andreas, die sich später Jesus anschlossen.
22.3.24
Die Umwertung der von Menschen gemachten Ordnung (Siegertypen, Reiche und Mächtige oben auf, gesunde und fitte Menschen allerorten etc.) ist ein Zeichen des apokalyptischen Umsturzes (Sturz der Mächtigem und Erhöhung der Niedrigen). Der Engel Gabriel ist der vorgeburtliche Bote Gottes sowohl bei Johannes als auch bei Jesus. Es war höchste Zeit! Zeit der Umkehr! Es hat die Stunde geschlagen! Keine Zeit mehr für Nebensächlichkeiten! Jetzt kommt es drauf an!
21.3.24
Jesus hatte eine durchaus kritische Einstellung zum Tempel in Jerusalem und damit zur Priesteraristokratie. Sein Wort, er werde den Tempel abreißen und einen anderen in drei Tagen aufbauen, wurde ihm u.a. zum Verhängnis. Dieses Wort steht in der Tradition der Propheten, die wie Jesaja sich darüber Gedanken machten, welche Rolle der Tempel spielen kann, wenn es zur großen Wallfahrt der Völker zum Zion kommen wird (Jesaja 25). In den Tempel ging man, um zu beten und zu opfern. Von Jesus wird folgendes berichtet: „Jesus ging zum Tempel hinauf und lehrte.“ (Johannes 7,14). Der Tempel war für ihn seit dem 12. Lebensjahr ein Bet-ha-Midrasch, ein Lehr- und Lernhaus. Der Grund für seinen späteren Wutausbruch, als er das Treiben im Tempel beobachtete.
20.3.24
Jesus und Johannes wurden in eine endzeitlich-apokalyptischen Grundstimmung hineingeboren und sind in ihr aufgewachsen. Zahlen spielen in der Apokalyptik eine große Rolle. Im Danielbuch wird die Zahl 70 genannt. Der Engel Gabriel, der Bote Gottes, spricht zu Daniel: „70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt; dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden.“ (9,26) Die 70 und die damit verbundene Prophezeiung übernimmt das Lukasevangelium und macht sie zum Zeitraster seiner Vorgeschichte. Von der Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers bis zur Ankündigung der Geburt Jesu sind es 6 Monate (Lukas 1,26), von der Ankündigung der Geburt Jesu bis zur Darstellung Jesu im Tempel sind es 9 Monate und 40 Tage (Lukas 2,22). Das sind – rechnet man den Monat mit 30 Tagen – 490 Tage, also 70 Wochen. Nach Lukas ist also mit Jesus die in Daniel prophezeite Endzeit angebrochen. Bei Jesus heißt das so: „Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“ Es sollte mit seinem Einzug in Jerusalem (kommender Palmsonntag) wirklich werden. 20 Jahre lang kann man nämlich nicht behaupten, dass etwas im Kommen sei. Irgendwann glaubt einem das niemand mehr.
19.3.24
Jesus war mit Johannes mütterlicherseits verwandt Er ließ sich von ihm taufen. Die Taufe durch Johannes und die Kreuzigung Jesu sind historisch gesichert. Jesus hat sich Johannes als Lehrer ausgesucht. Aber warum? Hatte er das nötig? Der außerbiblische Zeuge Josephus Flavius schreibt über Johannes: „Er war ein ehrenwerter Mann, der die Juden zur Tugendübung begeisterte, zur Gerechtigkeit gegeneinander, zur Frömmigkeit gegen Gott und zum Empfang der Taufe ermahnte.“ (Jüdische Altertümer XVII, 5,2) Von seinen Eltern Elisabeth und Zacharias heißt es, dass sie gerecht vor Gott waren und streng lebten nach den Geboten und Satzungen Gottes (Evangelium nach Lukas 1,6).
18.3.24
Jesus und sein Vater. Das war für ihn bald klar, wer das war. Der, der den ganzen Menschen will bzw. das Beste von ihm: seine Liebe. So ist es im Grundbekenntnis der Juden beschrieben: „Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.“ (5. Mose 6,4f.) Abbá war für ihn sein Gott. Von ihm kommt er nicht mehr los. Doch von seiner Mutter muss er sich lossagen. Sie war es, die ihn bedrängt und für verrückt erklärt hat. Auf ihre Vorwürfe antwortet er aus der Liebe zu seinem „Vater“ heraus. „Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ (Lukas 2,49)
17.3.24
Gestern klingelte es. Ich öffnete die Tür und wurde von zwei jungen Frauen begrüßt. Ich ahnte schon was, fragte aber trotzdem: „Was verschafft mir die Ehre?“ Sie waren geschmackvoll angezogen und attraktiv anzusehen. Sie hatten eine Einladung für mich zu einem „Gedenken an den Tod Jesu“. Das wird bei den Zeugen Jehovas in Endingen am Karfreitag wohl groß gefeiert. Ich sagte ihnen: „Da sind Sie bei mir gerade richtig. Ich bin Pfarrer.“ Das schreckte sie nicht. Sie wollten mir dann vom Sinn des Todes Jesu erzählen, ausführlich. Als ich erwiderte, dass dieser Tod komplett sinnlos gewesen war und nur von der Auferstehung her einen Sinn bekommen kann, hatte ich sie wohl vor den Kopf gestoßen. „Auferstehung?“, fragten sie mich. Ich verstand nicht richtig. „Der Tod Jesu erlöst uns von unseren Sünden.“ Ich fragte zurück: „Welche Sünden?“ Zu mehr kam es nicht zwischen uns – eigentlich schade, weil ich merkte, dass sie eine Antenne für Transzendenz hatten.
Der heutige Sonntag heißt „Judica“, abgeleitet von Psalm 43 („Verschaffe mir Recht, Gott!“ – lat. „Judica me Deus!“). Es geht um die Suche nach dem Recht, das einem unschuldig Leidenden zusteht und der Durchsetzung dieses Rechts. Also ein anderes Recht als das des Stärkeren. Es ist das Recht des Reiches Gottes, in dem die Armen vorne sitzen und die Letzten der Gesellschaft die Ersten sind. Verkehrte Verhältnisse!
16.3.24
Jesus, der Schüler! Nicht allwissend. In den „Kindheitserzählungen des Thomas“ allerdings wird Jesus als ein Kind dargestellt, dem man nichts mehr beibringen kann. Es ist allen – auch den Gelehrten – haushoch überlegen. Damit ist eine Jesusvorstellung verbunden, die ihn von jeder irdischen Wirklichkeit entrückt. Ein spielender Jesus mit dreckigen Kleidern? Aber unbedingt! Mir selbst ist in der S-Bahn auf der Fahrt von Bahlingen nach Freiburg in einer Unterhaltung mit einem älteren Mädchen diese Vorstellung eines chemisch-reinen Jesus begegnet. Ein „steriles“ Wesen, ein „Musterknabe“, der alles kann, den nichts erregt und aufregt. So einen Helden hätte man gern – gerade in frommen Kreisen. Leider ist dieser Super-Jesus nicht der Jesus der Bibel!
15.3.24
Im „Jüdischen Krieg“ II,8.2 berichtet Josephus Flavius, dass es im jüdischen Kloster Qumran am Toten Meer ein Internat gab, um die Jungen religiös zu bilden. Das zeigt, dass jüdische Kinder früh die Thora (auswendig) lernten, um die Weisungen Gottes auch leben zu können. Die 4. Klässler staunten heute nicht schlecht, als ich ihnen erzählte, dass Jesus nichts aufgeschrieben hat. Dass er alles, was er brauchte, immer bei sich hatte – und zwar in seinem Herzen. Das hat ihn gerettet, als der „Satan“ ihn rumkriegen wollte (Matthäusevangelium Kapitel 4). Und als er am Kreuz hing, fand er seine letzten Worte nicht aus sich selbst, sondern aus dem, was in ihm als Gottes Worte gelebt hat. PS: Wir sollten aufhören zu sagen, dass wir auswendig lernen. Wir sollten stattdessen „inwendig lernen“ sagen.
t14.3.24
Jesus konnte schon mit 6 Jahren Teile der Thora auswendig, weil er morgens und abends mit seinen Eltern das Schema Israel gebetet hat. Er lernte seinen Gott kennen im Gebet der Familie und in den Festen: im Opferfest, Wochenfest (vergleichbar mit Pfingsten), am Versöhnungstag, beim Laubhüttenfest, beim Sabbathessen und bei jeder Mahlzeit. Er hört die uralten Erzählungen von der Rettung Israels, von den Bundesschlüssen (Noah, Abraham, Mose, Josia, Nehemia). Jesus hat als Kind das Hören gelernt. Daraus entstand das Lernen. Kinder fragen. Jüdische Kinder werden früh zum religiösen Fragen erzogen. Dem Jüngsten der Familie ist es vorbehalten, bei der Feier des Pessach zu fragen: Was bedeutet diese Feier? Und dann hört er und lernte die Urgeschichte seines Volkes von der Befreiung in Ägypten kennen.
13.3.24
Und jetzt aufgepasst! Jesus wird in Matthäus 1,23 als Immanuel (hebr. Gott mit uns!) bezeichnet. Wenn er also Gott verkörperte auf dieser Erde, dann lernte Gott selbst in eben diesem Jesus seine eigenen Weisungen und Gebote am eigenen Leib kennen. In ihm lernte Gott selbst die Thora kennen, die er seinem Volk als Lebensgrundlage gegeben hat. Gott erfuhr durch Jesus, wie es war, diese Thora zu lernen und zu befolgen. Er lernte in Jesus auch, die Thora auszulegen: eng oder weit, belastend oder menschenfreundlich. Ob sie die Menschen aufrichtet oder niederwirft. Für Jesus war klar: die Thora seines „Vaters“ ist vollständig, nichts an ihr darf weggenommen oder hinzugefügt werden. Er hat die Autorität, diese Thora „göttlich“ auszulegen (Bergpredigt – „Ich aber sage euch!“). Jesus lernte die Weisungen Gottes im konkreten Leben seiner Familie. Er lernte sie im normalen Lebenszug von Arbeiten und Beten. Auswendig! Bis zur Reife. Und dann trat er in die Öffentlichkeit!
12.3.24
Die Verwandtschaftsverhältnisse Jesu: seine leibliche Mutter hieß Maria. Sie war verwandt mit Elisabeth, die aus dem Priestergeschlecht des Aaron kam. Ihr Mann Zacharias gehörte auch zu einem Priestergeschlecht. Sie waren ein thorakundiges Ehepaar. Elisabeth war mit Johannes schwanger, Maria mit Jesus. Maria besuchte ihre Verwandte Elisabeth. Bei diesem Besuch stimmte Maria das Magnificat an. Damit zeigte sie sich als thorakundige Frau, die in der Freiheitstradition Israels zu Hause ist (Lk 1,52: „Gewaltige hat ER (der Herr) vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht.“). So sang auch ihr biblisches Vorbild Miriam. Joseph, der Mann von Maria, war Davidide (siehe Matthäusevangelium). Und er war „gerecht“=zadak (hebr.). Das meint, dass er ein thorafrommer Jude war, der den Weisungen und Geboten Gottes entsprechend handelte. Er folgte dem Grundsatz: „Halte dich an die Weisungen Gottes, aber lege sie barmherzig aus.“ Deshalb stellte er Maria, die nicht von ihm schwanger war, nicht bloß. Er wollte sie heimlich verlassen, was der Engel Gottes ihm ausredete. Hätte er sie öffentlich verlassen, wäre sie vermutlich gesteinigt worden. Jesus wuchs also in einer Familie auf, die in und nach der Thora lebte. Und er lebte in dem Bewusstsein auf, dass er ein Nachkomme Davids war, des größten Königs von Israel.
11.3.24
Wo hatte Jesus seinen ersten Religionsunterricht? Es gibt eine Szene, die der Evangelist Lukas berichtet. Ein Bar Mizwa, ein 12-jähriger Jude (vergleichbar einem Konfirmanden heutiger Zeit), sitzt im Tempel in Jerusalem und diskutiert mit Schriftgelehrten. Sie staunen über seine Thorakenntnis. Wo hat dieser Junge das her? Ein Junge, der aus Nazareth stammt, wo es nur ein kleines jüdisches Lehrhaus gab? Die Kenntnis der Thora fällt nicht vom Himmel. Sie muss durch intensives Hören und Lernen erarbeitet werden. Von Jesus wird nicht berichtet, dass er etwas niedergeschrieben hat wie andere große Lehrer und Religionsstifter. Vom ersten Augenblick seines irdischen Lebens wurde Jesus in die Glaubenstraditionen seines Volkes eingeführt. Und er lernte und kannte sie auswendig. Das war die Voraussetzung für sein späteres Leben als wandernder Prediger…
10.3.24
Sonntag Lätare=freuen. Man nennt ihn auch den Sonntag des „kleinen Ostern“. Denn mitten im Leiden gibt es ein Lichtblick, weil der Trost nicht weit ist. Freude und Trost sind „Geschwister“. Es gibt ein Geheimnis heute: im Sterben eines Menschen für alle Menschen, in dieser völligen Hingabe zeigt sich, wozu die Liebe fähig ist. Jesus war diese Liebe Gottes. Er lebte sie mit Haut und Haaren in seinem Reich. Sie war für ihn das, was sich lohnte, gewollt zu werden. Unbedingt. Da kommt mitten auf dem Passionsweg ein Hauch von Freude auf – und Dankbarkeit!
9.3.23
Zur Zeit Jesu war die Zahl der Entwurzelten, also derer unter der Unterschicht, auf 30% der Gesamtbevölkerung angewachsen. In Lukas 6,20 und Matthäus 5,3 (Seligpreisungen) spricht Jesus diese Entwurzelten direkt an und sagt zu ihnen: „Ihr seid zu beglückwünschen. Denn euch gehört das Reich Gottes.“ Die Letzten und die Allerletzten werden da in der ersten Reihe sitzen. Diese Aussage Jesu ist nicht spirituell, sondern existentiell. Wie kam es zu diesem Verelendungsprozess in Galiläa und Judäa? Erstens: die überdimensionierte Bautätigkeit des Herodes verschlang Unsummen an Steuergeldern. Zweitens: der Zensus des Augustus (Lukas 2,1) forderte weitere Einnahmen. Drittens: an den Tempel musste der Zehnte abgeführt werden. Viertens: Missernten. Jesus war erschüttert von diesem Elend. Wer den Weg Jesu gehen will, muss sich also dem Thema „Armut“ widmen. Die Glaubwürdigkeit der Christen und der Kirchen steht und fällt mit diesem Thema.
8.3.24
Jesus ist nicht als fertige Person auf die Welt gekommen. In ihm ist entstanden, was er später geworden ist, gesagt und getan hat. Jesus ist aufgewachsen. Seine Familie war in der damaligen Unterschicht zu Hause. 3% zu seiner Zeit bildete die Oberschicht, also Menschen, die nicht arbeiten mussten. 5% bildeten die Mittelschicht. Das waren Goldschmieder und Kunsthandwerker. 80% bildeten die Unterschicht. Das waren Tagelöhner, normale Arbeiter und Sklaven. Sie hatten kein Geld, um Fleisch zu essen. Das war die gesellschaftliche Schicht, zu der Jesus gehörte. 10% waren Entwurzelte, also Bettler. Im Neuen Testament werden sie ptochoi genannt.
7.3.24
Es gibt Bücher, die erden. Das Buch von Wilhelm Bruners ist so ein Buch. Es heißt: „Wie Jesus glauben lernte“ und ist bei Herder erschienen. Dr. theol. Bruners war von 1987 bis 2006 im Benediktinerkonvent der Jerusalemer Dormitio-Abtei auf dem Zion und in Tagba. In den folgenden Tagen werden ich hier das Buch besprechen.
6.3.24
Die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind keine Geschichtsreportagen im modernen Sinn. Sie haben historische Informationen und haben vorrangig ein religiöses Interesse. Sie sind Propagandatexte. Sie werben für den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Juden Jesus von Nazareth. Sie sind eine einzigartige Textgattung. Sie sind nach Ostern geschrieben (70-90 n.Chr.). Historisches im nächtlichen Verhör nach Markus 14, 53ff.? Gesichert die Aussage Jesu: „Ich bin es.“ auf die Frage des Hohepriesters Kaiphas, ob er der Messias sein. Und die ergänzende Antwort: „Ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.“ Diese letzte Aussage Jesu ist deshalb gesichert historisch, weil sie als Prophezeiung nicht eingetroffen ist und niemand ein Interesse daran hat, eine nicht eingetroffene Prophezeiung in ein Evangelium einzubringen.
5.3.24
Jesus in Jerusalem. Warum nur? Seine Zeit in Galiläa war ok. Er selbst war ein Galiläer. Kapernaum am See Genezareth war seine Heimat geworden. Hier war sein EinundAlles entstanden. Das Reich Gottes – seine große Liebe. Sein Meer, in dem er sich bewegte wie ein Fisch. Sein Element, in dem und aus dem er lebte und das sein Leben ausfüllte. Warum nicht auch in Jerusalem? Was in Galiläa im Kleinen keimte, sollte und konnte es sich in Jerusalem nicht zur vollen Blüte entfalten? Es gab aus seiner Sicht nur diesen einen Grund, nach Jerusalem zu gehen. Doch wehe, du triffst auf eine Institution! Doch wehe, du willst dein zartes Pflänzlein in den harten Boden einer Machtzentrale einpflanzen! Doch wehe, du lieferst dein Bestes Leuten aus, die mit allen Abwassern dieser Welt gewaschen sind! Für Jesus gab es offenbar keine Alternative zu Jerusalem. Was in Galiläa möglich geworden war, sollte in Jerusalem wirklich werden. Doch die Möglichkeit des Herzens und die harte Realität einer möglichkeitsfremden Wirklichkeit finden nie zueinander. Das Harte wird das Sanfte immer kaputt machen. Statt eines seelsorglichen Gesprächs mit dem charismatischen Galiläer führte die geistliche Elite ein Verhör durch. Wie unpassend! Wie unsensibel! Wie armselig!
4.3.24
Der Mensch lernt immer noch was dazu. Manchmal ist das schmerzhaft. Ist man – so wie ich – nicht mehr berufstätig, muss man lernen sich einzureihen. Nicht mehr vorne stehen ist eine Erleichterung, aber auch ein Verlust. Im Leben gibt es also zugewiesene Plätze. Und wer sagt denn, dass die zweite oder dritte Reihe uninteressant sind?
3.3.24
Der Sonntag Okuli („Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten“ Psalm 34) ist geprägt von Lukas 9,62: „Wer sein Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Jesus war nun mal kompromisslos, wenn es um Alles ging. Das Reich Gottes war das, was sich für ihn lohnte, gewollt zu werden. Und deshalb war es logisch für ihn, diese „Rücksichtslosigkeit“ so an- und auszusprechen für die, die das genauso wollen wie er.
2.3.24
Ich suche nach meinem Leben in Seinem. Es sind zwei Elemente, die mich mit ihm verbinden. Geboren und begraben. Und was dazwischen geschieht. Was nicht wenig ist, aber auf dem Weg Jesu doch eine gewisse Relation erfährt, was gut tut. Geboren und begraben werden sind existentielle Ereignisse, die jedem Menschen widerfahren. Gelitten möchte ich für mich nicht ganz ausschließen. Doch hat sein Leiden Erlösungsqualität und deshalb bleiben die ersten beiden übrig. Das zu wissen ist wichtig für mich. Denn wer ein Wissen um etwas hat, hat auch ein Gewissen. Und wo aus einem Wissen ein Gewissen wird, erwächst ein Bewusstsein. Und wo ein Bewusstsein ist, ist Haltung. Selbstbewusstsein ist gut und wichtig. Doch ist es nicht das, was ein Christusbewusstsein ausmacht.
1.3.24
Was liegt zwischen geboren und gelitten? Ein Leben. Ein Arbeitsleben. Ein selbst bestimmtes Leben. Worte, Taten, gelebte Liebe. Nicht der Rede wert? Oft ist das, was nicht gesagt wird, besonders viel wert. Doch sollte man das, was man tun und erreichen kann mit seiner eigenen Kraft, nicht zu hoch hängen. Ist das die Botschaft dieses wortlosen Zwischenraums im Credo? Der hier beschriebene Weg Jesu ist anziehend. Es gibt noch mehr im Leben als Selbstbestimmtheit. Will er das sagen? Das Entscheidende geschieht davor und danach. Der Weg Jesu, auf den ich einbiegen kann, nimmt mich in Dimensionen mit, die ich selbst nicht schaffen kann.
29.2.24
Empfangen – geboren – gelitten – gekreuzigt – gestorben – begraben. Das sind die Passivverben, die die erste Hälfte des Lebens Jesu im Credo des 4. Jahrhunderts, das in den Kirchen bekannt wird, beschreiben. Hinabgestiegen – auferstanden – aufgefahren – sitzen – wieder kommen – richten. Das sind die Aktivverben, die die zweite Hälfte des Lebens Jesu beschreiben. Also eine passive und eine aktive Sichtweise des Lebens Jesu. Was aber ist zwischen begraben und hinabgestiegen passiert? Wie kam es zur Wandlung von Passivität zu Aktivität?
28.2.24
Jede Frage hat einen Kontext. Die Frage „Warum musste Jesus sterben?“ hat den nachösterlichen Kontext. Und es gibt im Neuen Testament darauf nicht die eine, sondern viele Antworten – in den Briefen des Paulus und in den Evangelien. Wer also den Menschen nur eine Antwort präsentiert („Jesus ist für unsere Sünden gestorben!“) macht sich schuldig am Reichtum der Heiligen Schrift und vergeht sich am Glauben der Menschen. Denn die verschiedenen Antworten sind nicht zufällig und auch nicht willkürlich. Sie berücksichtigen die Resonanz des Menschen. Nicht jede Antwort findet bei jedem Menschen denselben „Anklang“. Dieser Vielfalt muss der und die verantwortliche Geistliche gerecht werden. Andererseits gibt es hoffentlich auch mündige Gläubige, die sich keinen Bären aufbinden lassen und ihre Geistlichen fragen: „Ist das die einzige Antwort?“ Wenn die Antwort „Ja“ lautet, dann darf der Christ sagen: „Wirklich? Die sagt mir aber nichts. Ist das alles, was die Bibel zu bieten hat?“ Spätestens dann muss sich der oder die Geistliche ans Bibelstudium machen, sonst geht ihnen noch jemand verloren…
27.2.24
Gestern Abend im ZDF: „Sie sagt. Er sagt.“ von Baldur von Schirach. Ein Vergewaltigungsprozess. Der Verteidiger der Klägerin führt den Grundsatz „in dubio pro reo“ (Im Zweifel für den Angeklagten) auf überzeugende Weise ad absurdum. Ein anderer Grundsatz ist für mich genauso zweifelhaft: die Wahrheit sagen. Das forderte die Richterin von den aufgerufenen Zeugen. „Die Wahrheit sagen“ klingt für mich so, als wäre da ein Mensch, der sich entschließt, nach der Wahrheit zu greifen und sie zu „sagen“. Quasi so wie wenn man in einem Geschäft nach einer Ware greift und sie dann hat und in den Warenkorb legt. Die Wahrheit als verfüg- und vorzeigbares Produkt! Möglicherweise wollte von Schirach auch diesen Grundsatz anzweifeln. Denn „die Wahrheit sagen“ geht nicht. Die Wahrheit als isoliertes Produkt gibt es nicht. Sie ist immer personenbezogen und es gibt sie nur auf der Beziehungsebene. Deshalb sollte die Frage der Richterin lauten: „Möchten Sie hier in diesem Gerichtssaal uns und allen Anwesenden gegenüber als wahrhaftige Person auftreten und ehrlich zu uns sein?“ Die „Wahrheit sagen“ ist eine Erwartung, die sich an einem Ideal orientiert. An Idealen ist aber die Menschheit noch immer gescheitert.
26.2.24
Das Menschliche ist wichtig – auch in der Kirche. Und manchmal ist ein Mensch einfach nicht zu ertragen – auch in der Kirche. Wie wohltuend ist ein Mensch, der auf einen zukommt und eine Zurückhaltung ausstrahlt, noch bevor er ein Wort gesprochen hat. Und es kommt ein Mensch auf einen zu, der einem die Luft nimmt, nachdem er einen Satz gesprochen hat, weil er sein dominantes Wesen verbergen kann. Gegenwart ist etwas sehr Heikles. Und gerade in ihr geschehen die wesentlichen Dinge des Lebens.
25.2.24
Der heutige Sonntag „Reminiscere“ („Gedenke!“) nimmt uns mit zur Barmherzigkeit Gottes. Er hat seinen Namen aus Psalm 25, wo es in Vers 6 heißt: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.“ Das dürfen wir und zu Zeiten, die zum Himmel schreien, sollen wir Gott wachrütteln und ihn an sein Wesen erinnern – sein Barmherzig sein. Sie ist es, die Jesus in Person war. Er war es, der sein Herz bei den Armen hatte, was im eigentlichen Sinn „Barmherzigkeit“ bedeutet.
24.2.24
Soll Kirche politisch sein? Auf jeden Fall. Allein schon ihre Existenz ist ein Politikum. Deshalb befremdet mich das Wort der katholischen Bischofskonferenz, demnach ein Christ niemals die AfD wählen dürfte, weil sie im Kern eine völkische Partei sei. Wenn die Kirche politisch sein will, dann darf sie nicht parteipolitisch argumentieren. Sie muss geistlich argumentieren. Aber sind wir im Blick auf die AfD schon so weit wie 1934, als sich die Bekennende Kirche leider zu spät zum Barmer Bekenntnis durchrang? Wenn schon, dann muss die Kirche in ihrem wegweisenden Wort auf ihrem Niveau bleiben. Und das ist geistlich. Die Frage an einen Christen würde dann heißen: Wenn du an Jesus, den auferstandenen Juden glaubst – kann du in diesem Glauben guten Gewissens die AfD wählen?
23.3.24
Wirklichkeitsmensch und Möglichkeitsmensch – eine hilfreiche Unterscheidung von Robert Musil. Von Franz Kafka sagt man, er sei ein Virtuose der Möglichkeiten gewesen. Doch was macht ein solcher Virtuose mit dem Nadelöhr der Wirklichkeit? Und muss sich ein Wirklichkeitsmensch nicht immer wieder mal fragen, ob er hinter seinen Möglichkeiten bleibt?
22.2.24
Der transzendente Mensch hat die wichtigste Frage des Lebens beantwortet: Was lohnt es, gewollt zu werden? Mit seiner Antwort, die er lebt, hat er keinen Platz in der Tagesordnung der Welt, zu der auch die Kirche gehört. Nach Kierkegaard kann nur der Einzelne die Wahrheit sein. Und das ist der transzendente Mensch. Deshalb fasziniert mich Jesus. Seine Antwort auf die Frage „Was lohnt es, gewollt zu werden?“ war das „Reich Gottes“. Deshalb war er nicht verheiratet. Das war der entscheidende Punkt, um von seiner Familie als „verrückt“ bezeichnet zu werden. Transzendenz und „laufender Betrieb“ kommen niemals zueinander. „Was sich gehört“ und „sein muss“ passen nicht zu einem transzendenten Menschen. Seine Antwort, die er lebt, ist sein Preis für ein „anderes“ Leben, das ihn zum Außenseiter macht. Der Antipode des transzendenten Menschen ist der Oberflächliche.
21.2.24
Großes Leid gibt es da, wo ein Mensch bevormundet wird und sich nicht entfalten kann.
20.2.24
Freiheit und Abstand sind Wohltaten des Alters.
19.2.24
Der Mensch hat eine Schieflage. Er möchte allmächtig sein. Das drückt sich in seinem Sorgen und seinem Hadern aus. Mit den Sorgen meint er, die Zukunft in den Griff zu bekommen. Mit dem Hadern meint er, die Vergangenheit ändern zu können. Wer kapiert, dass das keinen Sinn macht, lebt leichter. Jesus meinte, es sei eh besser, sich nicht zu sorgen und lieber die Blumen zu betrachten und über den Flug der Vögel zu staunen. Im JETZT leben könnte eine tägliche Übung sein.
18.2.24 Sonntag Invocavit
Im Bezug auf das Glaubensbekenntnis könnte man sich fragen: Was ist eigentlich passiert zwischen „Begraben“ und „Hinabgestiegen“? Wer das möchte, kann sich mit der aktuellen Predigt auf dieser Homepage unter „Predigten“ beschäftigen.
17.2.24
„Dem Herren musst du trauen, wenn dir´s soll wohlergehn; auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 361,2 Paul Gerhardt)
16.2.24
Die Kirche muss es vormachen. Sie muss sich der ständigen Aufgabe unterwerfen, ihre Worte und ihre Taten zu reflektieren und sich ihrer Wurzel bewusst zu werden. Das muss sie tun, wenn sie sich nicht verlieren will an Parteien und gesellschaftliche Strömungen. Dieser Prozess der Selbstreflexion ist die Grundbedingung dafür, dass Kirche als Botschafterin der Transzendenz geschätzt wird. Kirche ist für alle da. Aber nicht für jede Meinung.
15.2.24
Als ich in den 1980er Jahren mit meinen Konfirmanden das KZ Dachau besuchte, wollten wir in München auch in die Synagoge gehen. Sie lag in der Reichenbacherstraße. Als wir da ankamen, war das eine lange Straße mit Wohnblocks. Da also musste die Synagoge sein. Wir mussten nicht lange suchen. Denn sie wurde (damals schon) von einem Polizeiauto bewacht.
14.2.24
Aschermittwoch! Wird ab heute bis Ostern so hart gefastet wie zuvor ausgelassen gefeiert wurde? Oder geht man einfach nur zur Tagesordnung über? Und verpasst damit die Chance zur Transformation des eigenen Lebens?
13.2.24
Wer gegen Antisemitismus auf die Straße geht, sollte auch wissen, wofür er sich einsetzt. Was weiß ein so Demonstrierender von den Semiten und den Juden? Von Dietrich Bonhoeffer stammt der Ausruf: „Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen.“ Sein Freund Eberhard Bethge hat das festgehalten. Ob es eine Reaktion Bonhoeffers auf die Rassengesetze von 1935 oder die Reichskristallnacht von 1938 war, ist nicht belegt. Was bedeutet die Überzeugung Bonhoeffers heute? Schön singen reicht nicht. Wer Lieder singt, die Jesus preisen, muss wissen, dass Jesus Jude war. Aus einem Lobpreislied muss der engagierte Einsatz für die Judenheit in Deutschland werden, sonst sind solche Lieder nur Geplärr (vgl. die Kultkritik des Propheten Amos).
12.2.24
Was ist die Wahrheit? Nach Sören Kierkegaard muss die Frage heißen: Wer ist die Wahrheit? Und seine Antwort war: der Einzelne. Nur ein einzelner Mensch kann die Wahrheit sein. Konsequenterweise war die Masse für Kierkegaard suspekt bis verdächtig.
11.2.24
Fasnetsonntag! Fasnetsonntag? Die Fasnet hat mit dem Sonntag so wenig zu tun wie der Sonntag mit der Fasnet. Der „Narr um Christi willen“ (1. Korinther 4,10) ist keine Silberberghexe. Die Kirche sollte „verrückt nach Christus“ sein. Attraktiv ist die Kirche, wenn sie bei ihrer eigenen „Verrücktheit“ bleibt. Dem Fasten als christliche Tugend muss nicht ein Fress- und Saufgelage vorausgehen – wie seit dem 13. Jahrhundert belegt. Die Zeiten sind vorbei, in denen den Menschen bestimmte Speisen und Getränke von einer moralischen Institution für bestimmte Zeiten verboten werden. Fasten im modernen Sinn ist Maßhalten das ganze Jahr über. Extreme in jede Richtung sind nicht gesund.
10.2.24
Man kann Menschen nur gewinnen, wenn man sie nicht verloren gibt.
9.2.24
„Was passiert an Fastnacht?“, fragte ich heute in der 4. Grundschulklasse. Antwort: „Da wird der Winter vertrieben.“ Ich frage zurück: „Welcher Winter? Wieso soll etwas vertrieben werden, was es gar nicht mehr gibt?“ Die Schüler schauen mich fassungslos an, stimmen mir zu und kommen von selbst auf das Thema „Klimawandel“. „Man könnte aber die Autos vertreiben und alles Böse in der Welt“, schlug ein Schüler vor. Fastnacht verbinden die Kinder mit Verkleiden und Spaß. Und nicht vergessen, wo das Ganze herkommt: Carne valis = „Fleisch lebe wohl!“.
8.2.24
Das Leben kann kein Spiel sein. Siegen und verlieren sind keine Kategorien für das Leben. Siegen und verlieren machen so gesehen auch keinen Sinn. Sie sind nicht nachhaltig. Ich frage mich ernsthaft: Was überwiegt beim Spielen mehr: die Lust zu gewinnen oder die Angst, nicht verlieren zu können?
7.2.24
Seit einiger Zeit beschäftigt mich die Frage: Was lohnt es, gewollt zu werden? Die Frage führt mich über mich selbst hinaus. Nur wohin? Jesus hat diese Frage für sich mit dem Einsatz für das „Reich Gottes“ beantwortet. Deshalb hat er auf einen zentralen Lebensinhalt eines damaligen jüdischen Mannes und Rabbis verzichtet: heiraten und Familie haben. Es geht also nicht darum zu fragen: Was will ich? Sondern darum zu fragen (wenn man sich denn auf diese Fährte begeben will): Was lohnt es, gewollt zu werden?